Bericht über die 4. Amphibienzählung bzw. Einsammlung 2015 in
der Gemeinde Georgenberg durch Natur- und Landschaftsschutzwart des
Oberpfälzer Waldvereins, Zweigverein Georgenberg, Rainer Folchmann
Die Krötenwanderungen in unserer Gemeinde Georgenberg werden jetzt
schon zum vierten Mal überwacht auch für das Umweltamt in Augsburg
Gebietsleiterin Frau Langensiepen registriert und kartiert. Als
Natur- und Landschaftsschutzwart des OWV Georgenberg ist für die
seltenen Insekten und Reptilien sowie für seltene Pflanzenarten
Rainer Folchmann zuständig (Fotodokumentation). Der OWV leistet
damit einen enorm wichtigen Beitrag zum Naturschutz sowie zur
Erhaltung seltener Tier- und Pflanzenarten.
Wie immer ging der Aktion für die Aufstellung der Amphibienzäune an den ST 2154 von Georgenberg nach Waldkirch am „Kohlenmeiler und in der „Kannerskurve“ sowie an der ST 2396 von Georgenberg in Richtung Galsterlohe am Ortsende von Georgenberg durch das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach mit dem Technischen Amtsrat Johann Baumer - in diesem Fall die Straßenmeisterei Vohenstrauß mit dem Leiter Helmut Peintinger - voraus. Eingebunden war außerdem das Team um Karl Feiler. Herr Baumer hatte dazu Rainer Folchmann zum
„Privaten Betreuer“ der Amphibienzäune bestellt. „Die Zusammenarbeit war wieder vorzüglich“, wieß der Natur- und Landschaftswart hin und weiß diese Unterstützung zu schätzen. Das gilt auch für den Vorsitzenden des OWV-Zweigvereins, Manfred Janker. Die weiteren vier Teammitglieder (Amphibienzähler) sind ehrenamtliche Helfer und keine OWV-Mitglieder.
Rainer Folchmann seiner Einladung zu einem „Kindertag“ hatten hatten
die OWV-Mitgiederkinder gerne angenommen uns sind Zahlreich
erschienen und unterstützten Rainer Folchmann beim Einsammeln der
Amphibien / Reptilien am Amphibienzaun in Georgenberg in Richtung „Spreißl-Weiher“.
Es wurden dabei 331 Kröten,71 Teichmolche und 5 Bergmolche
eingesammelt.. Da es sich in Georgenberg um den derzeit stärksten
Amphibienzaun im Landkreis
Neustadt a. d. Waldnaab handelt ist es für die Kinder sehr lehrreich
mit den Populationen in Kontakt zu kommen und damit plichtbewußter
in Sachen Naturschutz verständlicher weise umzugehen.
Die jetzigen Lebensräume müssen in Zukunft auf jeden Fall genauer
inspiziert werden, damit diese für die seltenen Pflanzen, Flechten,
Reptilien und Amphibien unbedingt erhalten werden können. Dazu kommt
für den OWV die Frage, welche Lebensräume so umgestaltet werden,
damit sich seltene Pflanzen- und Tierarten heimisch fühlen können.
Unterstützunmg findet der Landschafts und Naturschutzwart des
OWV-Georegenberg dabei auch vom Staatlichen
Forstamt-Flossenbürg deren Chef Herrn Bösl und Forstamtfrau Frau
Bruglachner-Zaschka zuständig für den Raum Georgenberg. Dann wurde
Herrn Folchmann die Unterstützung vom Naturpark Frau Mathilde
Müllner und von der Unteren Naturschutzbehörde Frau Rossmann für die
Kartierung der Populationen zugesichert.
Der Drang der Amphibien zu
ihren Laichplätzen war laut Folchmann wieder enorm groß. Das
Einsammeln der Tiere nahm er gemeinsam mit seinem Team zwei bis drei
Mal am Tag vor. Z
„ Das Ergebnis ist überwältigend“, freut sich Rainer Folchmann. Die vierte Einsammlung zeigt das Ergbnis das sich die Populationen der Erdkröten, Fröschen , Molchen und Echsen sowie bastardisierte Kröten langsam wieder erholen . „Diesen Erfolg ist dank der vorangegangenen Einsammlungen '2012 - '2014 zu erkennen“
Die gesamte Aktion war laut Folchmann auf 41 Tage verteilt. 293
Stunden und 2337 gefahrene Kilometer sprechen für sich.
Hier die Ergebnisse:
Rote Zahlen bedeuten Rückgang der Populationen gegenüber dem Vorjahr.
ST 2154 „Kannerskurve“
nur Sichtungen da
Amphibienröhren vorhanden sind
Vorjahr
Kröten 166 Stück (499 Stück )
Froscharten:
Wasserfrosch - Stück (1 Stück)
Grasfrosch 1 Stück ( Vorwarnliste BY ) (3 Stück )
Molcharten:
Teichmolch - Stück ( Vorwarnliste BY ) (5 Stück )
Bergmolch - Stück (9 Stück )
ST 2154 „Kohlenmeiler“
Kröten 101 Stück (79 Stück )
Froscharten:
Grasfrosch - Stück ( Vorwarnliste BY ) (4 Stück )
Molcharten:
Teichmolche 109 Stück ( Vorwarnliste BY ) (5 Stück )
Bergmolche 14 Stück (3 Stück )
Waldeidechse 2 Stück (1 Stück)
(Vorwarnliste BY)
Zauneidechse
1 Stück
(Rote Liste Kategorie 3 Bedrohte Art gefährdet BY
ST 2396 am Ortsausgang Georgenberg
Kröten
2305 Stück
(2257 Stück )
Kreuzkröten
3 Stück
(3 Stück )
(Rote Liste Kategorie 2 bedrohte Art stark gefährdet BY)
Bastardisierte Unterart der Kreuzkröte
63 Stück
(Rote Liste Kategorie 2 bedrohte Art stark gefährdet BY)
Froscharten:
Grasfrosch 6 Stück (Vorwarnliste BY) (2 Stück )
Springfrosch - Stück (- Stück )
Wasserfrosch - Stück (1 Stück)
Molcharten:
Teichmolch 467 Stück (Vorwarnliste BY) (168 Stück)
Bergmolch 51 Stück (40 Stück)
Kammmolch - Stück (1 Stück)
(Rote Liste Kategorie 2 Bedrohte Art stark gefährdet BY)
Zauneidechse 14 Stück (2 Stück)
(Rote Liste Kategorie 3 Bedrohte Art gefährdet BY)
Waldeidechse 3 Stück (1 Stück)
(Vorwarnliste BY)
Insgesamt:
Kröten 2572 Stück (2835 Stück)
mit 3 Kreuzkröten und 80 bastardisierte Unterart der Kreutzkröte
(Rote Liste Kategorie 2 Bedrohte Art stark gefährdet BY) (gleich)
Grasfroch 7 Stück (Vorwarnliste BY) (9 Stück)
Wasserfrosch
-
Stück
(2 Stück)
Teichmolch 576 Stück (Vorwarnliste BY) (178 Stück)
Bergmolch 65 Stück (52 Stück)
Zauneidechse 15 Stück (2 Stück)
(Rote Liste Kategorie 3 Bedrohte Art gefährdet BY)
Waldeidechsen 5 Stück (Vorwarnliste BY) (2 Stück)
Fazit:
Es ist zu beachten das bei der Kannerskruver St2154 nur Sichtungen
gemacht wurden,
man kann davon ist auszugehen von der Quersumme den vorangegangenen
Zählungen das die Krötenpopulation sich auf ca. 2900 Stück beläuft
!!!
Allgemein gilt: Neben der Anlage der Laichgewässer muss eine
dauerhafte Pflege der Strukturen gewährleistet sein!
Außerdem zählt der Amphibienzaun als größter im Landkreis Neustadt
a. d. Waldnaab.
In unserer Gemeinde Georgenberg sind nicht nur seltene Pflanzen und Tiere gefährdet, sondern Insekten und auch einige Reptilien bzw. Amphibienpopulationen.
Das Leben und die Fortpflanzung unserer heimischen Amphibienarten sind eng an das Wasser gebunden. Zum Ablegen ihrer Eier (Laich) müssen sie in jedem Frühjahr ihre Laichgewässer aufsuchen. Die erste Lebensphase verbringen die Amphibien als Kaulquappen (Larven) im Wasser. Nach einer Umgestaltung des Körpers (Metamorphose) beginnen sie ihr Landleben und kehren meist nur zur Fortpflanzungszeit ins Wasser zurück. Viele Arten werden erst nach einigen Jahren geschlechtsreif, Erdkrötenweibchen zum Beispiel nach drei bis fünf Jahren. Sie können sehr alt werden und viele Nachkommen haben. Laichgewässer sowie Sommer- und Winterlebensraum sind oft weit voneinander entfernt. So müssen bei der Frühjahrswanderung oft große Entfernungen zurückgelegt werden. Von der Erdkröte sind Wanderungen von mehr als zwei Kilometern bekannt und selbst beim Kammmolch wurden Wanderdistanzen von mehr als einem Kilometer festgestellt. Die Prägung auf das Laichgewässer erfolgt während der Larven- bzw. Kaulquappenphase. Viele Amphibien kehren dann zur Fortpflanzung an ihr Geburtsgewässer zurück. Amphibien sind wechselwarme Tiere. Ihre Körpertemperatur ist von der Umgebungstemperatur abhängig; sie können allerdings aktiv besonnte oder schattige Plätze aufsuchen. Kälte und knappe Nahrung zwingen zur Winterruhe. Zum Überwintern werden passende Verstecke, wie der Wurzelbereich von Bäumen, Erdlöcher, Felsspalten, Hohlräume unter Steinplatten, unter totem Holz oder in Kleinsäugerbauten aufgesucht. Ein Teil der Frösche überwintert im Bodenschlamm der Laichgewässer. Erst im Frühjahr werden sie wieder aktiv.
Die Haut der Amphibien trägt im Gegensatz zu den Kriechtieren oder Reptilien (Eidechsen, Schlangen) kein Schuppenkleid. Ihre wasserdurchlässige, kaum noch verhornte Haut bindet sie zeitlebens an Feuchtbiotope. Sie schützen sich vor ihren Feinden, indem sie Schleim mit Giftstoffen aus ihrer Haut absondern. Amphibien ernähren sich hauptsächlich von Würmern, Schnecken, Insekten und anderen Gliedertieren. In unseren Gärten sind sie daher sehr nützlich.
Ist eine kleine bis mittelgroße Giftschlange aus der Familie der Vipern (Viperidae). Sie besitzt von allen Vipern das größte und zugleich das nördlichste Verbreitungsgebiet, zudem ist sie die einzige Schlangenart, die auch nördlich des nördlichen Polarkreises angetroffen werden kann.
 Kreuzotter " Giftig " |
 Kreuzotterkopf |
Die Kreuzotter erreicht eine Durchschnittslänge zwischen 50 und 70 Zentimetern, kann im Extremfall aber auch bis etwa 90 Zentimeter lang werden. Die größte in Deutschland gefundene Kreuzotter war ein Weibchen von 87 Zentimetern in Thüringen. Die Weibchen sind im Regelfall deutlich länger als die Männchen, die eine Körperlänge von 60 Zentimetern in der Regel nicht überschreiten. Der Körper der Schlange ist gedrungen gebaut, der Kopf für eine Viper vergleichsweise wenig deutlich vom Körper abgesetzt. Die Schnauze ist vorn gerundet und geht in eine flache Kopfoberseite über, der Canthus rostralis ist ebenfalls abgerundet. Der Kopf ist von der Oberseite betrachtet oval und am Hinterkopf durch die Giftdrüsen leicht verbreitert. Als Anpassung an kühle Lebensräume ist sie in der Lage, ihren Körper durch aktives Abspreizen der Rippen zu verbreitern, um eine größere Fläche für die Wärmeaufnahme beim Sonnen zu bieten und so geringere Wärmestrahlungsmengen effektiver zu nutzen. Die Grundfärbung der Kreuzotter ist sehr variabel und reicht von silbergrau und gelb über hell- und dunkelgrau, braun, blau-grau, orange, rotbraun und kupferrot bis schwarz. Die Färbung ist innerhalb der Art sehr variabel, auch innerhalb derselben Population können unterschiedliche Färbungen auftauchen. Das auffälligste Zeichnungsmerkmal ist ein dunkles Zickzack-Band auf dem Rücken. Ebenso wie die Grundfarbe kann auch die Rückenzeichnung sehr variabel ausgebildet sein. Die Variationen reichen von breit oder schmal ausgebildeten Zickzacklinien über Wellen- und Rautenbänder bis hin zu einzelnen Querbinden, wie sie vor allem bei der Unterart V. b. bosniensis ausgebildet sind. Vor allem in Österreich und Slowenien kommen zudem Populationen vor, die eine dunkle Grundfarbe mit heller oder hell umrandeter Zeichnung besitzen. An den Flanken befindet sich außerdem eine Reihe dunkler, runder Flecken.
Nicht selten werden Schlingnattern (nicht Giftig) fälschlicherweise für Kreuzottern gehalten !!!
Der Kopf weist meist die gleiche Grundfarbe wie der Körper auf, besonders bei den Weibchen kann das Rostrale und der Canthus rostralis leicht gelblich braun sein. Am Hinterkopf besitzen die Tiere eine x-förmige oder eine V-förmige Zeichnung mit zum Kopf weisender Spitze, die vom Zickzackband des Rückens getrennt ist.
Über die Augen zieht sich ein breites Schläfenband bis zum Hals. Viperntypisch sind die senkrecht geschlitzten Pupillen, die von einer rostroten Iris umgeben sind. Die Bauchseite ist graubraun, schwarzbraun oder schwarz gefärbt und weist vor allem an der Kehle und in der Kinnregion häufig hellere Flecken auf. Die Unterseite der Schwanzspitze kann gelb, orange oder ziegelrot sein. Die Rückenschuppen der Kreuzotter sind mit Ausnahme der untersten Reihe deutlich gekielt und haben eine raue Oberfläche. Die Beschuppung des Kopfes kann bei der Kreuzotter sehr variabel sein. Die Kopfoberseite ist mit vielen kleinen Schuppen bedeckt, der unpaare Stirnschild (Frontale) sowie die paarigen Scheitelschilde (Parietale) sind allerdings groß und vollständig ausgebildet. Zwischen dem Auge und den acht bis neun, seltener sechs bis zehn, Oberlippenschilden (Supralabialia) besitzt die Schlange im Regelfall eine Reihe Unteraugenschuppen (Suboculare).
Kreuzottern sind sehr scheu. Bei Gefahr flüchten sie sofort. Ein
Zubiss erfolgt nur dann, wenn man sie massiv bedroht, sie anfasst
oder auf sie tritt !!!
Die Schlingnatter (Coronella austriaca)
Auch Glattnatter genannt, ist eine zur Familie der Nattern (Colubridae) gehörende, recht kleine und unscheinbare Schlangenart, die in weiten Teilen Europas und im westlichen Asien vorkommt. Auch in Mitteleuropa ist sie weit verbreitet. Für den Menschen ist diese ungiftige Schlange völlig harmlos – nicht selten wird sie allerdings mit der Kreuzotter verwechselt. Beide Arten stehen in vielen Ländern unter Naturschutz und dürfen weder verfolgt noch gefangen werden.
 Schlingnatter " Ungiftig " |
 Schlingnatter " Ungiftig " |
Merkmale:
Schlingnattern sind recht zierliche, schlanke Schlangen; sie erreichen eine Körperlänge von etwa 60 bis 75, gelegentlich 80 Zentimeter (in Einzelfällen wurden auch Exemplare von rund 90 cm Gesamtlänge beobachtet). Ein Größenunterschied zwischen den Geschlechtern ist nicht signifikant. Der Schwanz macht etwa 12 bis 25 Prozent der Gesamtlänge aus. Er verjüngt sich gleichmäßig und endet mehr oder weniger spitz. Der Oberkopf ist abgeflacht, die Seiten und die Spitze der Schnauze sind rundlich. Die Augen sind relativ klein und weisen eine runde Pupille auf (ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zur Kreuzotter); die Iris ist bräunlich. Hinsichtlich der Kopf- und Körperbeschuppung (vergleiche: Schlangenbeschuppung) sind unter anderem folgende Eigenschaften zu nennen: Es bestehen jederseits sieben Oberlippenschilde (Supralabialia) und acht bis neun Unterlippenschilde (Sublabialia). Die Grundfärbung der Oberseite ist grau, graubraun, bräunlich oder rötlich-braun. Bei Männchen dominieren braune bis rötliche Farbtöne, während die Weibchen oft eher grau sind. An den Kopfseiten befindet sich je ein charakteristischer dunkelbrauner Streifen, der vom Nasenloch über das Auge bis zum Mundwinkel verläuft. Auf der Kopfoberseite fällt ein herz- bzw. hufeisenförmiger dunkler Fleck auf (das „Krönchen“), der sich häufig in zwei Längsstreifen auf dem Rücken fortsetzt, um sich schließlich meistens in zwei (selten vier) Fleckenreihen aufzulösen. Schwanzwärts werden diese Flecken immer undeutlicher. Gelegentlich können die Flecken auch zu Querstreifen verschmelzen. Bei aller Variabilität des dorsalen Fleckenmusters weist die Schlingnatter aber kein Zickzackband auf, wie es Kreuzottern haben. Jedoch kann durch Bewegungen der Schlange ein solcher Eindruck entstehen. Die Bauchseite ist nie wie bei der Ringelnatter gelblich-weiß, sondern es herrschen auch hier verschiedene Braun- und Grautöne vor – oft mit einer lebhaften dunklen Sprenkelung versehen.
Die Schlingnatter ist in Europa weit verbreitet und erreicht auch Teile Westasiens. In der Schweiz, in Österreich und Deutschland ist die Schlingnatter ebenfalls weit verbreitet, aber nicht flächendeckend vertreten. In der Schweiz gilt die Art als die Schlange mit dem größten Verbreitungsgebiet, wobei aber die Fundpunktdichte lokal sehr stark variiert und zudem in den letzten Jahrzehnten erhebliche Bestandsrückgänge zu konstatieren waren (vgl. Abschnitt „Gefährdung und Schutz“). Der höchstgelegene Nachweis in den Zentralalpen liegt auf 2100m.
In Deutschland liegt der Verbreitungsschwerpunkt der Schlingnatter in wärmebegünstigten Mittelgebirgsregionen Südwest-, Süd- und Südostdeutschlands (oft zugleich Weinanbaugebiete), während sich das Areal nach Norden hin immer mehr in Teilgebiete auflöst und die Populationsstärken abnehmen. In weiten Bereichen Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommern fehlt die Art gänzlich (Ausnahmen sind isolierte Vorposten an der Ostseeküste zwischen Rostock und dem Darß, auf Hiddensee und Rügen sowie in der Ueckermünder Heide). Ansonsten werden im Norddeutschen Tiefland vor allem die Heide- und Sandgebiete Brandenburgs, Teile des vor allem mittelniedersächsischen Geest- und Moor-Tieflands sowie der Westfälischen Bucht besiedelt im Bayerischen Wald bis 850 m (sonst sind es in den Mittelgebirgen Deutschlands selten über 650 m).
Die Schlingnatter ist eine (trockenheits- und wärmeliebende) Tierart, die je nach Region ein recht breites Spektrum von Biotoptypen besiedelt, Sandheiden, Magerrasen sowie trockene Hochmoor- und Waldränder wichtige Lebensräume darstellen, sind es in den mitteleuropäischen Mittelgebirgen vor allem wärmebegünstigte Hanglagen mit Mager- und Trockenrasen, Geröllhalden, Trockenmauern und aufgegebenem Rebgelände (Weinberge). In höheren Mittelgebirgslagen, in Ostbayern oder auch in Südschweden bilden besonnte Waldränder in Nachbarschaft von extensiv bewirtschafteten Wiesen, Gebüschsäume, Hecken, Waldschläge, Felsheiden, halbverbuschte Magerrasen und Böschungen das Biotopspektrum der Schlingnatter. Im gleichen Habitat kommen meist auch viele Eidechsen (insbesondere Zauneidechsen, regional auch Waldeidechsen oder Mauereidechsen) und Blindschleichen vor. Gelegentlich tritt zudem die Kreuzotter auf. Schlingnattern verharren oft regungslos und vertrauen darauf, dass sie die unscheinbare Färbung und das Fleckenmuster optisch mit der Umgebung verschmelzen lässt. Fühlen sie sich ohne Fluchtmöglichkeit in die Enge getrieben und bedroht, ringeln sie sich tellerförmig zusammen und heben den Vorderkörper S-förmig an. Zischlaute geben sie dabei nur selten von sich. In fortgesetzter Bedrängnis versuchen sie den Angreifer auch sehr oft zu beißen. In dem Fall lässt die Schlange nicht sofort wieder los, sondern führt mitunter kauende Bewegungen durch. Beim Menschen hinterlassen die kleinen Zähnchen aber nicht mehr als ein paar Kratzer.
Rainer Folchmann
Landschafts -und Naturschutzwart des OWV-Georgenberg
Tätigkeitsbericht 2014 vom Landschafts -und Naturschutzwart
Für unseren Naturschaukasten an der Mühle Gehenhammer habe alle Präparierten Tiere fotografiert und anschließend diese dann auch mit Lateinischen Namen bestimmt. Die Liste der bestimmten Tiere habe ich an unseren Vorstand Herrn Manfred Janker weitergeleitet. Dieser hat dann die Fa. Regler in Altenstadt bei Neustadt a. d. Waldnaab beauftragt zur Anfertigung der Namensschilder für die Präparierten Tiere. Herr Bock von der Oberen Naturschutzbehörde Sitz in Regensburg wurde darüber informiert damit der OWV-Georgenberg für die Tiere im Naturschaukasten eine Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung erhalten kann. Gefährdete Arten habe ich mit farblich markierten Punkten verdeutlicht. Die Ausnahmegenehmigung aller Präparierten Tiere wurde erteilt. Meiner Einladung zur Besichtigung des Amphibienzaunes in Georgenberg fand Interesse bei Frau Mathilde Müllner von Naturpark nördlicher Oberpfälzer Wald und Frau Vidal von Unteren Naturschutzbehörde. Beide waren sich über die Wichtigkeit des großen Teiches in Georgenberg einig. Dieser Teich gilt offiziell als Laichteich. Der Amphibienzaun ist der größte und artenreichste Zaun im ganzen Landkreis NEW, bestätigten beide Damen. Für die Mitglieder des OWV-Georgenberg habe ich wieder ein Kindertag zur Begehung der Amphibienzäune und zur Verdeutlichung der Amphibien für die Kinder veranstaltet. Der seltene Kammmolch wurde Fotografiert und dokumentiert, leider wurde ein Rückgang einiger Populationen verzeichnet näheres können Sie auf der Homepage des OWV-Georgenberg / Naturschutzseite nachlesen. Während der Fertigung des Abschnittes der Staatsstraße ST2154 bei der Kanneskurve, fand mit mir eine Begehung zur Begutachtung der beiden dort eingebauten Amphibienröhren statt. Zur Begutachtung sind Herr Hain Technischer Amtsmann von Staatlichen Straßenbauamt Weiden, der dortiger Bauleiter der Straßenbaufirma,Forstamtfrau Frau Bruglachner-Zaschka sowie von der Gemeinde Georgenberg Herr Josef Pilfusek. Es wurde auch über den Einbau einer Amphibienröhre beim Kohlemeiler bei Georgenberg ST 2154 gesprochen meine Vorschläge habe ich schon 2012 über beide Problemzonen Kanneskurve und Kohlemeiler dargestellt. Eine Begehung bei der Kanneskurve ST2154 von Georgenberg Richtung Waldkirch fand auch mit mir und dem Technischen Amtsrat Herrn Baumer vom Staatlichen Straßenbaumamt Amberg/Sulzbach statt sowie Karl Feiler von der Straßenmeisterei Vohenstrauß. Gesprochen wurde über das dort geplante Amphibienleitzaunsystem. Auch das Problem bei der Auffahrt zur Familie Bäumler in Georgenberg wurde angesprochen. Erst 2016 könnte dort eine Amphibienstopprinne eingebaut werden,dies bedarf einer genaueren Überprüfung. Es würde davon keine Gefährdung für Verkehrsteilnehmer ausgehen. Hiermit möchte ich mich für das Aufstellen der Amphibienzäune wie jedes Jahr beim Staatlichen Straßenbauamt Vohenstrauß unter der Leitung von Herrn Peitinger sowie bei Karl Feiler und sein Team bedanken bedanken. Mein Dank gilt auch an das Staatliche Forstamt Flossenbürg Herrn Bösl und Forstamtfrau Frau Bruglachner-Zaschka und der Gemeinde Georgenberg die mich bei meinen Aktionen unterstützen. Die Kartierung in Georgenberg 2015 für das Landesamt für Umwelt Sitz in Augsburg wegen der Förderung des Geodatengerätes wird noch von der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt Neustadt an der Waldnaab geprüft.
Ein Dankeschön an die Pächter Herr und Frau Graf das diese mich beim Blumengießen der Beete an der alten Mühle unterstützen
Mit freundlichen Grüßen Rainer Folchmann

Hauhechel-Bläuling oder Gemeiner Bläuling (Polyommatus (Aricia) icarus) ist in vielen Regionen sicherlich die häufigste Bläulingsart

Der Kleine Weinschwärmer (Deilephila porcellus) ist ein Schmetterling (Nachtfalter) aus der Familie der Schwärmer (Sphingidae) Fotografiert von Familie Vogl aus Waldkirch

Der Schwarzkolbige Braun-Dickkopffalter (Thymelicus lineola) zählt wie der Braunkolbige Braun-Dickkopffalter zu den häufigen Dickkopffalterarten

Der Gelbe Fleckleibbär oder Gelbe Tigermotte (Spilosoma lutea) ist ein Schmetterling (Nachtfalter) aus der Unterfamilie der Bärenspinner (Arctiinae)

Teichmolch-Männchen (Triturus vulgaris) in Landtracht mit Bildung
eines Rückenkammes für die Wassertrac Vorwarnliste

Bergmolch-Mänchen (Triturus alpestris) in Landtracht
mit Bildung eines Rückenkammes für die Wassertracht

Kopf der Blindschleiche (Anguis fragilis) Ein anderer verbreiteter Irrglaube ist,
dass die
Blindschleiche blind sei Vorwarnliste

Die Blindschleiche (Anguis fragilis) ist eine Echsenart innerhalb der Familie
der Schleichen (Anguidae) Vorwarnliste

Die Blasenflechte (Hypogymnia physodes) ist eine der häufigsten Laubflechten in Österreich und Deutschland

Das Etagenmoos oder Stockwerkmoos (Hylocomium splendens) ist ein häufiges Wald- und Wiesenmoos

Der Husarenknopf (Sanvitalia procumbens) gelegentlich auch unter der Bezeichnung Miniatursonnenblume, Aztekengold ist eine Art aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae)

Das Schmalblättrige Weidenröschen auch als Stauden-Feuerkraut, Waldweidenröschen oder Waldschlagweidenröschen (Epilobium angustifolium) ist eine Pflanzenart aus der Familie der Nachtkerzengewächse (Onagraceae)
Bericht über die dritte Amphibienzählung bzw. Einsammlung
2014 in der Gemeinde Georgenberg durch Natur- und
Landschaftsschutzwart des Oberpfälzer Waldvereins, Zweigverein
Georgenberg, Rainer Folchmann
Die Krötenwanderungen in unserer Gemeinde Georgenberg werden nun
schon zum dritten Mal überwacht sowie für das Umweltamt in Augsburg
registriert und kartiert. Als Natur- und Landschaftsschutzwart des
OWV Georgenberg ist für die seltenen Insekten und Reptilien Rainer
Folchmann zuständig (Fotodokumentation). Der OWV leistet damit einen
enorm wichtigen Beitrag zum Naturschutz sowie zur Erhaltung seltener
Tier- und Pflanzenarten.
Wie immer ging der Aktion die Aufstellung der Amphibienzäune an den
ST 2154 von Georgenberg nach Waldkirch am „Kohlenmeiler und in der „Kannerskurve“
sowie an der ST 2396 von Georgenberg in Richtung Galsterlohe am
Ortsende von Georgenberg durch das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach
mit dem Technischen Amtsrat Johann Baumer - in diesem Fall die
Straßenmeisterei Vohenstrauß mit dem Leiter Helmut Peintinger -
voraus. Eingebunden war außerdem das Team um Karl Feiler. Baumer
hatte dazu Folchmann zum „Privaten Betreuer“ der Amphibienzäune
bestellt. „Die Zusammenarbeit war wieder vorzüglich“, weiß der
Natur- und Landschaftswart die Unterstützung zu schätzen. Das gilt
auch für den Vorsitzenden des OWV-Zweigvereins, Manfred Janker. Die
weiteren vier Teammitglieder (Amphibienzähler) sind ehrenamtliche
Helfer und keine OWV-Mitglieder.
Folchmanns Einladung zu einem „Schnupperabend“ hatten die
Diplom-Biologin Mathilde Müller von der Geschäftsstelle des
Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald e. V. und Carmen Vidal von
der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Neustadt a. d.
Waldnaab gerne angenommen und sich am Amphibienzaun in Georgenberg
in Richtung „Spreißl-Weiher“ über die Aktivitäten des
OWV-Zweigvereins informiert. Müllner bestätigte Folchmann und Janker
dabei, dass es sich in Georgenberg um den derzeit stärksten
Amphibienzaun im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab handelt. Außerdem
kommen viele und seltene Tierarten vor.
Die jetzigen Lebensräume müssen in Zukunft auf jeden Fall genauer
inspiziert werden, damit diese für die seltenen Pflanzen, Flechten,
Reptilien und Amphibien unbedingt erhalten werden können. Dazu kommt
für den OWV die Frage, welche Lebensräume so umgestaltet werden,
damit sich seltene Pflanzen- und Tierarten heimisch fühlen können.
„Durch den sehr milden Winter ging die Amphibienwanderung dieses Mal
ungewöhnlich frühzeitig voran“, beschreibt Folchmann die Aktion.
„Der Laich der Frösche und Kröten hatte an manchen Stellen schon
Anfang März begonnen, sodass alles früher seinen Weg gefunden hatte.
Aber die Natur kann man nicht beeinflussen.“ Der Drang der Amphibien
zu ihren Laichplätzen war laut Folchmann wieder enorm groß. Das
Einsammeln der Tiere nahm er gemeinsam mit Janker zwei bis drei Mal
am Tag vor. Zum Ende kamen in nur drei Tagen 233 Kröten, darunter
auch Weibchen, vom Laichteich als sogenannte „Rückläufer“ in
Richtung Wald zurück.
„Summa summarum war das Ergebnis überwältigend“, freut sich
Folchmann. Neben Erdkröten, Fröschen und Molchen hatte er auch
bedrohte Tierarten gefunden, darunter den Kammmolch sowie
bastardisierte Kröten. „Leider
mussten wir aber einen Rückgang bei den Bergmolchen, Teichmolchen
und Grasfröschen sowie bei den Erdkröten feststellen“, bedauert der
OWV-Wart. „Um den Erfolg der vorangegangenen Einsammlungen zu
erkennen, tritt dieser je nach Populations- Geschlechtsreife bei den
Kröten und Molchen erst zwischen 2015 und 2017 ein“, weist Folchmann
noch hin.
Die gesamte Aktion war laut Folchmann auf
29 Tage verteilt. 209 Stunden und 1638 gefahrene Kilometer sprechen
außerdem für sich.
Hier die Ergebnisse:
Rote Zahlen
bedeuten Rückgang der Populationen gegenüber dem Vorjahr.
ST 2154 „Kannerskurve“
Vorjahr
Kröten
499
Stück
(656 Stück )
Froscharten:
Wasserfrosch
1
Stück
(keinen )
Grasfrosch
3 Stück (
Vorwarnliste BY )
(6 Stück )
Molcharten:
Teichmolch
5 Stück
(
Vorwarnliste BY )
(23 Stück )
Bergmolch
9 Stück
(20
Stück )
ST 2154 „Kohlenmeiler“
Kröten
79
Stück
(105 Stück )
Froscharten:
Grasfrosch
4
Stück (
Vorwarnliste BY
)
(2 Stück )
Molcharten:
Teichmolche
5 Stück
(
Vorwarnliste BY )
(4 Stück )
Bergmolche
3 Stück
(5 Stück )
Waldeidechse
1
Stück
ST 2396 am Ortsausgang Georgenberg
Kröten
2257 Stück
(2221 Stück )
Kreuzkröten
3 Stück
(3 Stück )
(Rote Liste Kategorie 2 bedrohte Art stark
gefährdet BY)
Bastardisierte Unterart der Kreuzkröte
80 Stück
(Rote Liste Kategorie 2 bedrohte Art stark gefährdet BY)
Froscharten:
Grasfrosch
2
Stück (Vorwarnliste BY
)
(7
Stück )
Springfrosch
keinen
(keinen )
Wasserfrosch
1
Stück
Molcharten:
Teichmolch
168 Stück
(
Vorwarnliste BY )
( (164 Stück)
Bergmolch
40
Stück
(59 Stück)
Kammmolch
1
Stück
(Rote Liste Kategorie 2 Bedrohte Art stark gefährdet BY)
Zauneidechse
2 Stück (Vorwarnliste BY )
(1 Stück)
Waldeidechse
1
Stück
Insgesamt:
Kröten
2835 Stück
(2985 Stück)
mit 3 Kreuzkröten und 80 bastardisierte Unterart der Kreutzkröte (Rote Liste Kategorie 2
Bedrohte Art stark gefährdet BY)
(gleich)
Grasfrosch
9 Stück (Vorwarnliste BY)
( (15 Stück)
Wasserfrosch
2 Stück
Teichmolch
178 Stück (Vorwarnliste
BY)
(191 Stück)
Bergmolch
52 Stück
(84 Stück)
Zauneidechse
2 Stück
(1 Stück)
Waldeidechsen
2 Stück
Fazit:
Allgemein gilt: Neben der Anlage der Laichgewässer muss
eine dauerhafte Pflege der Strukturen gewährleistet sein!
Außerdem zählt der Amphibienzaun als größter im Landkreis
Neustadt a. d. Waldnaab.
In unserer Gemeinde Georgenberg sind nicht nur seltene
Pflanzen und Tiere gefährdet, sondern Insekten und auch einige
Reptilien bzw. Amphibienpopulationen.
Lebensweise der
Amphibien:
Das Leben und die Fortpflanzung unserer heimischen Amphibienarten
sind eng an das Wasser gebunden. Zum Ablegen ihrer Eier (Laich)
müssen sie in jedem Frühjahr ihre Laichgewässer aufsuchen. Die erste
Lebensphase verbringen die Amphibien als Kaulquappen (Larven) im
Wasser. Nach einer Umgestaltung des Körpers (Metamorphose) beginnen
sie ihr Landleben und kehren meist nur zur Fortpflanzungszeit ins
Wasser zurück. Viele Arten werden erst nach einigen Jahren
geschlechtsreif, Erdkrötenweibchen zum Beispiel nach drei bis fünf
Jahren. Sie können sehr alt werden und viele Nachkommen haben.
Laichgewässer sowie Sommer- und Winterlebensraum sind oft weit
voneinander entfernt. So müssen bei der Frühjahrswanderung oft große
Entfernungen zurückgelegt werden. Von der Erdkröte sind Wanderungen
von mehr als zwei Kilometern bekannt und selbst beim Kammmolch
wurden Wanderdistanzen von mehr als einem Kilometer festgestellt.
Die Prägung auf das Laichgewässer erfolgt während der Larven- bzw.
Kaulquappenphase. Viele Amphibien kehren dann zur Fortpflanzung an
ihr Geburtsgewässer zurück. Amphibien sind wechselwarme Tiere. Ihre
Körpertemperatur ist von der Umgebungstemperatur abhängig; sie
können allerdings aktiv besonnte oder schattige Plätze aufsuchen.
Kälte und knappe Nahrung zwingen zur Winterruhe. Zum Überwintern
werden passende Verstecke, wie der Wurzelbereich von Bäumen,
Erdlöcher, Felsspalten, Hohlräume unter Steinplatten, unter totem
Holz oder in Kleinsäugerbauten aufgesucht. Ein Teil der Frösche
überwintert im Bodenschlamm der Laichgewässer. Erst im Frühjahr
werden sie wieder aktiv. Die Haut der Amphibien trägt im Gegensatz
zu den Kriechtieren oder Reptilien (Eidechsen, Schlangen) kein
Schuppenkleid. Ihre wasserdurchlässige, kaum noch verhornte Haut
bindet sie zeitlebens an Feuchtbiotope. Sie schützen sich vor ihren
Feinden, indem sie Schleim mit Giftstoffen aus ihrer Haut absondern.
Amphibien ernähren sich hauptsächlich von Würmern, Schnecken,
Insekten und anderen Gliedertieren. In unseren Gärten sind sie daher
sehr nützlich.
Der Nördliche Kammmolch
(Rote Liste Kategorie 2 Bedrohte Art stark
gefährdet BY)
Der Nördliche Kammmolch (Triturus
cristatus) - im deutschen Sprachraum wird er in der Regel
einfach als Kammmolch bezeichnet - ist eine Art der
Amphibien aus der
Ordnung der
Schwanzlurche. Innerhalb der
Gattung
Triturus bildet er
zusammen mit inzwischen fünf anderen, vormals als Unterarten
behandelten Arten, die
Kammmolch-Superspezies.
Merkmale:
Der Nördliche Kammmolch ist ein recht großer, kräftiger Wassermolch
mit breitem Kopf. Die Männchen erreichen eine Länge von zehn bis
maximal 18 Zentimetern, die Weibchen von elf bis maximal 20
Zentimetern. Die Oberseite ist grau-schwarz gefärbt, mit
undeutlichen dunkleren Punkten oder Flecken; die Haut erscheint
leicht warzig gekörnelt. Die Flanken sind im Übergang zur Bauchseite
intensiv weißlich granuliert. Der Bauch ist gelb oder orange mit
schwarzen Flecken. Dieses Fleckenmuster ermöglicht bei
feldbiologischen Untersuchungen sogar die individuelle
Unterscheidung der Tiere. Zur Paarungszeit entwickeln die Männchen
als Wassertracht einen hohen, stark gezackten Hautkamm auf Rücken
und Schwanz, der an der Schwanzwurzel unterbrochen ist (im Gegensatz
zum
Teichmolch).
Charakteristisch ist bei den Männchen außerdem ein perlmutt-silbriges
Band („Milchstreifen“) an den Schwanzseiten und eine stärker
gewölbte, schwarze
Kloake. Die Weibchen
verfügen nur über einen niedrigen Schwanzflossensaum. Bei ihnen
setzt sich die orange Bauchfärbung über die Kloake auf der unteren
Schwanzkante fort. In Nordeuropa sollen auch komplett schwarze
Kammmolche vorkommen. Nach dem Gewässeraufenthalt wird im Spätsommer
die Wassertracht, insbesondere die auffälligen Hautsäume der
Männchen, weitgehend zurückgebildet und weicht einer unscheinbareren
Landtracht.
Gefährdung:
Kammmolche leiden wie alle mitteleuropäischen Amphibien vor allem
unter der Zerstörung oder Beeinträchtigung von Kleingewässern in der
Kulturlandschaft durch Zuschüttung oder Eintrag von Müll und
Umweltgiften (vor allem
Pestizide aus der
Landwirtschaft). Auch die Einschwemmung von Düngerstoffen belastet
viele Gewässer und trägt zu ihrer vorzeitigen Verlandung durch
Eutrophierung bei. Werden
von Menschen Fische in Kleingewässer eingesetzt, die dort
natürlicherweise nicht vorkommen würden, führt dies in der Regel zum
Zusammenbruch von Lurchpopulationen, da deren Laich und Larven von
den meisten Fischen gefressen werden. Auch ein zu starkes Aufkommen
von Bäumen nah am Ufer entwertet die Laichgewässer, wenn dadurch zu
wenig Sonneneinstrahlung zur Wasserfläche durchdringen kann.Als
„Teilsiedler“ mit jahreszeitlich unterschiedlichen Lebensräumen
reagieren Kammmolche und andere Arten aber auch empfindlich auf
Landschaftsveränderungen im weiteren Umfeld der Gewässer. So führt
die Abholzung von Hecken und anderen Feldgehölzen zum Verlust von
Sommer- bzw. Überwinterungshabitaten. Intensive
Flächennutzungen sowie der Bau und Betrieb von Straßen haben eine
Trennwirkung zwischen den Teillebensräumen, so dass dort kein
ausreichender räumlicher Austausch von Individuen mehr stattfinden
kann.


Kammmolch-Männchen
Bauchseite
Kammmolch in Landtracht mit Teichmolch
Teichfrosch
Der Teichfrosch (Pelophylax
kl. esculentus, Pelophylax "esculentus"
oder Rana "esculenta"),
ungenauer auch Wasserfrosch
genannt, gehört innerhalb der Ordnung der
Froschlurche zur Familie
der
Echten Frösche (Ranidae). Außerdem wird er nach Aussehen, Lebensweise und
Verwandtschaftsbeziehungen zu den
Wasserfröschen gerechnet, die
neuerdings von vielen Autoren in eine eigene Gattung
Pelophylax gestellt werden. Innerhalb dieses schwer zu
überschauenden
taxonomischen Komplexes
handelt es sich beim Teichfrosch nicht um eine biologische
Art im klassischen
Sinn, sondern um eine hybridogenetische
Hybride aus dem
Seefrosch (Pelophylax
ridibundus) und dem
Kleinen Wasserfrosch (Pelophylax
lessonae). Aufgrund besonderer
genetischer Sachverhalte
kann der Teichfrosch jedoch auch ohne
Rückkreuzung mit den
Elternarten existieren und sich fortpflanzen.
Merkmale:
Die äußeren Merkmale des Teichfrosches liegen idealerweise
intermediär zwischen denen
seiner Elternarten
Kleiner Wasserfrosch und
Seefrosch. Je nach
genetischer Disposition kann ein
Individuum aber auch
entweder mehr der einen oder der anderen Art ähneln. Dies betrifft
sowohl die Körpergröße als auch die Färbung und Zeichnung der
Oberseite, des Bauches und der Gliedmaßen oder auch beispielsweise
die Länge der Unterschenkel in Relation zur
Kopf-Rumpf-Länge. Sogar für den
Fersenhöcker an der
hinteren, inneren Zehe trifft diese vermittelnde Stellung zu. Beim
Teichfrosch ist der Callus
internus genannte Fersenhöcker erhabener und im Verhältnis zur
Zehenlänge größer als beim Seefrosch, jedoch kleiner und
asymmetrischer als beim Kleinen Wasserfrosch. Exemplare mit
genetischer Nähe zum Seefrosch werden bis zu neun Zentimeter
(Männchen) bzw. elf Zentimeter (Weibchen) lang. Im „Normalfall“ ist
die Oberseite grasgrün gefärbt – gelegentlich aber auch braun – und
von einer hellgrünen Linie längs der Rückenmitte (von der
Schnauzenspitze bis zur Kloake) sowie zwei deutlich hervortretenden
Rückendrüsenleisten geprägt. Auch dunkle Punkte und Flecken sind oft
zu erkennen. Selbst die Lautäußerungen vermitteln zwischen den
Elternarten: Die Paarungsrufe sind nicht so schwirrend wie bei
Pelophylax lessonae,
sondern für das menschliche Ohr etwas deutlicher in ihren einzelnen
Tonfolgen wahrnehmbar, aber doch weniger abgehackt als das „Keckern“
des Seefrosches. Wie alle Wasserfrösche besitzt der Teichfrosch zwei
äußere
Schallblasen, die sich in
den seitlichen Mundwinkeln befinden und ihn zu lauten Rufen
befähigen. Bei ihm sind sie in der Regel weißlich-grau gefärbt (beim
Seefrosch dunkler grau, beim Kleinen Wasserfrosch weiß).


Teichfrosch
Teichfrosch
Rainer
Folchmann
Natur- und
Landschaftsschutzwart des Oberpfälzer Waldvereins, Zweigverein
Georgenberg e. V.

Die Schmuckfliege (Otites centralis) Gattung (Ulidiidae, syn. Otitidae) sind eine
Familie der Zweiflügler (Diptera) und gehören zu den Fliegen (Brachycera)

Larve des Weichkäfer auch Soldatenkäfer genannt (Cantharidae) sind eine Familie der Käfer (Coleoptera),die weltweit verbreitet sind .

Die Rostrote Winkelspinne (Malthonica ferruginea, Synonym Tegenaria ferruginea)
auch Hausspinne genannt,ist eine Art der Gattung der Winkelspinnen .
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Larve des Marienkäfer (Coccinellidae)

Der Große Schillerfalter (Apatura iris) ist ein Schmetterling (Tagfalter) aus der Familie der Edelfalter (Nymphalidae) Fotografiert in Unterrehberg von Wanderfreunde aus dem Harz.
" Art der Vorwarnliste "

Die Achateule, oder auch Mangoldeule (Phlogophora meticulosa) ist ein Schmetterling (Nachtfalter) und gehört zur Familie der Eulenfalter (Noctuidae) Fotografiert auf der Brünst von Motorradfreunden aus Potsdam .

Die Vierfleckkreuzspinne (Araneus quadratus) ist eine Spinnenart aus der Familie der Echten Radnetzspinnen (Araneidae) Die Art ist farblich sehr variabel und kann ausgesprochen farbenprächtig sein.

Die Regenbremse (Haematopota pluvialis) Sie ist eine Fliegenart aus der Familie der Bremsen (Tabanidae) Nach dem Stich folgt wie bei den meisten eine Quaddelbildung.
Sie können Krankheiten übertragen !!!

Männlicher Grasfrosch (Rana temporaria) bewacht Laich
Fotografiert in Oberrehberg bei Familie Wloka
" Art der Vorwarnliste "

Gemeine Raubfliege (Tolmerus atricapillus) beim Beutezug und frißt einen Zünsler (Pyralidae)
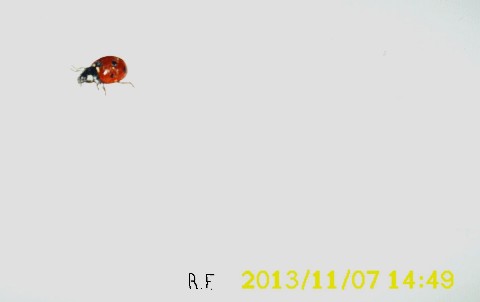
Der Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septempunctata) ist die wohl bekannteste Art aus der Familie der Marienkäfer (Coccinellidae)

Der Siebenpunkt-Marienkäfer oder Siebenpunkt (Coccinella septempunctata)

Der Labkrautschwärmer (Hyles gallii) ist ein Schmetterling (Nachtfalter) aus der Familie
der Schwärmer (Sphingidae) Fotografiert bei Waldkirch von Familie Langner
Wanderfreunde aus Brandenburg
" Kategorie 2 stark gefährdet "

Der Labkrautschwärmer (Hyles gallii) Totfund Fotografiert in Georgenberg von Familie Langner
Wanderfreunde aus Brandenburg
" Kategorie 2 stark gefährdet "

Der 19 Punkt Asiatische Marienkäfer (Harmonia axyridis) ist ein Käfer
aus der Familie der Marienkäfer (Coccinellidae)

Er wird auch als Vielfarbiger 19 Punkt-Asiatische Marienkäfer (Harmonia axyridis)
oder Harlekin-Marienkäfer bezeichnet

Nachher der alte Grünblaue,Braunsporige oder Blaue Träuschling (Stropharia caerulea) " Essbar "

Der junge Grünblaue,Braunsporige oder Blaue Träuschling (Stropharia caerulea) " Essbar "

Der Graubinden-Labkrautspanner (Epirrhoe alternata) ist ein Schmetterling (Nachtfalter) aus der Familie der Spanner (Geometridae)

Der Ockergelbe Blattspanner (Camptogramma bilineata) auch Löwenzahnspanner oder Brennnesselspanner genannt ist ein Schmetterling (Nachtfalter) aus der Familie der Spanner (Geometridae)

Der Braune Bär (Arctia caja) ist ein Schmetterling (Nachtfalter) " Vorwarnliste"
Fotografiert in Waldkirch von Familie Folchmann

Brauner Bär Arctia caja (L., 1758) aus der Unterfamilie der Bärenspinner (Arctiinae) " Vorwarnliste " Fotografiert in Waldkirch von Familie Folchmann

:
Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum) ist ein
Schmetterling (Nachtfalter) aus der Familie der Schwärmer (Sphingidae)

Das Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum), auch Karpfenschwanz oder Kolibrischwärmer genannt ist ein Nachtfalter (Schmetterling)

Der Große Kohlweißling-Weibchen (Pieris brassicae) ist ein Schmetterling (Tagfalter) aus der Familie der Weißlinge,der auch zur biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt wird

Weißstieliger Adern-Dachpilz (Pluteus phlebophorus (Ditmar Fr.) P. Kumm) " ungeniesbar "

Gurkenschnitzling oder Gemeine Gurkenschnitzling (Macrocystidia cucumis) " ungeniesbar "

Der Fichten-Reizker (Lactarius deterrimus) ist eine Pilzart aus der Familie der Täublingsverwandten " Essbar "

Das Pfennigkraut (Lysimachia nummularia), auch Münzkraut oder Pfennig-Gilbweiderich genannt
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Kaffeebrauner
Gabeltrichterling (Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer
" Essbar "

Weißer Senf (Sinapis
alba L., Syn. Brassica alba L.) gehört zur Familie der
Kreuzblütengewächse (Brassicaceae)
und liefert als Gewürzpflanze einen der Grundstoffe des Senfgewürzes

Wildwachsendes Sedum Crassula
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Außerdem fand 1. Vorstand Manfred bei einer Wanderung im Josephsthal (CZ) 3 Bischofsmützen, dies ist eine Lorchelart (Gyromitra infula) . Zum Essen für spezielle Genießer, da kein besonderer Speisepilz.

Außerdem fand 1. Vorstand Manfred bei einer Wanderung im Josephsthal (CZ) 3 Bischofsmützen, dies ist eine Lorchelart (Gyromitra infula) . Zum Essen für spezielle Genießer, da kein besonderer Speisepilz.
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Manfred Janker geht seit 55 Jahren in die Pilze. Doch heuer hatte er besonderes Glück im Bezug auf Exoten.
Er fand bei einer Wanderung den sehr seltenen Aniszähling (Lentinellus cocheleatus) , welcher ein sehr guter Speisepilz ist.

Manfred Janker geht seit 55 Jahren in die Pilze. Doch heuer hatte er besonderes Glück im Bezug auf Exoten.
Er fand bei einer Wanderung den sehr seltenen Aniszähling (Lentinellus cocheleatus) , welcher ein sehr guter Speisepilz ist.
%20ist%20eine%20Art%20der%20Gattung%20Fomes%20aus%20der%20Familie%20der%20Stielporlingsverwandten%20(Polyporaceae)%20%20Der%20Name%20entstand%20a%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Der Zunderschwamm (Fomes fomentarius) ist eine Art der Gattung Fomes aus der Familie der Stielporlingsverwandten (Polyporaceae) Der Name entstand
aus der früheren Verwendung als Zunder
" Fotografiert '2013 von Manfred Janker OWV-Georgenberg "

Trompetenflechte (cladonia fimbriata)
Potenziell Bedroht Art Kategorie 4
%20auch%20Bergeidechse%20oder%20Mooreidechse%20(2)%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Waldeidechse (Zootoca vivipara vormals Lacerta vivipara) auch Bergeidechse oder Mooreidechse
%20ist%20sehr%20variabel%20und%20reicht%20von%20silbergrau%20und%20gelb%20ber%20hell-%20und%20dunkelgrau%20braun%20blau-grau%20orang%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Grundfärbung der Kreuzotter (Vipera berus) ist sehr variabel und reicht von silbergrau und gelb über hell- und dunkelgrau braun blau-grau orange (Weibchen)
Fotografiert am 06.07.2013 von Erich Lehmeier Mitglied des OWV-Georgenberg
" Giftschlange " / Kategorie 2 stark
gefährdet
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Kreuzotter-Kopf (Vipera berus) (Weibchen)
Fotografiert am 06.07.2013 von Erich Lehmeier Mitglied des OWV-Georgenberg
" Giftschlange " / Kategorie 2 stark
gefährdet
%20ist%20eine%20kleine%20bis%20mittelgrosse%20Giftschlange%20aus%20der%20Familie%20der%20Vipern%20(Viperidae)%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Kreuzotter (Vipera berus) ist eine kleine bis mittelgrosse Giftschlange aus der Familie der Vipern (Viperidae) (Weibchen)
Fotografiert am 06.07.2013 von Erich Lehmeier Mitglied des OWV-Georgenberg
" Giftschlange " / Kategorie 2 stark
gefährdet
%20auch%20Zyane%20genannt%20und%20gehoert%20nicht%20zu%20den%20ursprnglich%20%20einheimischen%20Pflanzen%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Kornblume (Centaurea cyanus) auch Zyane genannt und gehoert nicht zu den ursprünglich einheimischen Pflanzen
%20ist%20in%20der%20Imkerei%20aufgrund%20des%20hohen%20Zuckergehalts%20ihres%20Nektars%20eine%20geschaetzte%20Nebentracht%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Kornblume (Centaurea cyanus) ist in der Imkerei aufgrund des hohen Zuckergehalts ihres Nektars eine geschaetzte Nebentracht
%20auch%20Wiesen-Witwenblume%20Naehkisselchen%20oder%20Wiesenskabiose%20genannt%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Acker-Witwenblume (Knautia arvensis) auch Wiesen-Witwenblume Nähkisselchen oder Wiesenskabiose genannt
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Nachtviolen (Hesperis)
Die%20verbreitete%20Annahme%20dass%20Schnaken%20den%20Menschen%20stechen%20ist%20bereits%20dadurch%20widerlegt%20dass%20die%20Mundwerkzeuge%20%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Schnake (Flabellifera pectinicornis) Die verbreitete Annahme dass Schnaken den Menschen stechen ist bereits dadurch widerlegt dass die Mundwerkzeuge die menschliche Haut nicht durchdringen.
%20sie%20werden%20normalerweise%20den%20Muecken%20(Nematocera)%20zugeordnet%20%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Schnake (Tipulidae) sie werden normalerweise den Muecken (Nematocera) zugeordnet

Ringelnatterhaut-Kopf zu sehen im Naturschaukasten bei der Alten Mühle Gehenhammer
Fotografiert%20von%20Ingeborg%20Folchmann%20in%20Waldkirch%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Ringelnatterhaut (Kettenhemd)Fotografiert von Ingeborg Folchmann in Waldkirch
%20-%20Samenknospen%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Große Klette (Arctium lappa) - Samenknospen
" Wildgemüse "
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Große Klette (Arctium lappa)
" Wildgemüse "
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Frauenmantel (Alchemilla)
%20auch%20Fuchs-Greiskraut%20oder%20Kahles%20Hain-Greiskraut%20genannt%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Das Fuchssche Greiskraut (Senecio ovatus) auch Fuchs-Greiskraut oder Kahles Hain-Greiskraut genannt
" Giftig "
.jpg)
Grasfrosch (Rana temporaria) andere Farbvariante Fotografiert am 28 07 2013 um 20:33 Uhr von Familie Hofer aus Neukirchen
" Vorwarnliste "
%20andere.jpg)
Grasfrosch (Rana temporaria) andere Farbvariante und sondert Sekret zur Verteidigung ab Fotografiert bei Georgenberg von Rainer Folchmann
" Vorwarnliste "
%202%20Cent-Stueck%20gross%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Kröten-Baby (Bufo Bufo) 2 Cent-Stück groß
%201%20Landgang%20nach%20der%20Metamorphose%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Kröten-Baby (Bufo Bufo) 1 Landgang nach der Metamorphose
Fotografiert von Rainer Folchmann in Waldkirch
%203%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Kröten-Baby (Bufo Bufo)
" Die Geschlechtsreife tritt nach 3 - 5 Jahren ein "
%20ungenauer%20auch%20Wasserfrosch%20genannt%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Seerose mit Teichfrosch (Pelophylax kl esculentus Pelophylax esculentus oder Rana esculenta) ungenauer auch Wasserfrosch genannt
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Schneeglöckchen (Galanthus)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Wilder Krokus (Crocus vernus)

Hornissennest im Vogelnistkasten bei der Alten - Mühle Gehenhammer

Grasfrosch Männchen und Weibchen
" Vorwarnliste "

Europäischer Maulwurf ( talpa europaea Linnaeus) (Totfund)

Europäischer Maulwurf ( talpa europaea Linnaeus) (Totfund)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Ringelnatter-Weibchen (natrix natrix)
Fotografiert in Waldkirch bei Familie Zeschick
" Kategorie 3 gefährdet"

Ringelnatter Kopf
" Kategorie 3 gefährdet"


Pflaumen-Gespinstmottenraupe (Yponomeuta padella) frühes Stadium ist ein Schmetterling (Nachtfalter) aus der Familie der Gespinst- und Knospenmotten (Yponomeutidae). "Schädling"
Bericht über die 2.Amphibienzählung-einsammlung '2013 in der Gemeinde Georgenberg durch Naturschutzwart / Landschaftsschutzwart des OWV-Georgenberg Rainer Folchmann
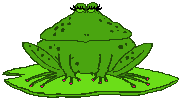
Es
ist wieder soweit ! ! ! Die Krötenwanderungen in unserer Gemeinde
Georgenberg sollen zum zweiten Mal überwacht, registriert und kartiert
werden. Darüber Kenntnis erhält das Landesumweltamt in Augsburg. Somit
hat der OWV Georgenberg einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz sowie
zur Erhaltung seltener Tier- und Pflanzenarten beigetragen.
Die
Aufstellung der Amphibienzäune an den ST 2154 Georgenberg nach Waldkirch
am "Kohlemeiler" und in der "Kannerskurve" sowie die ST 2396 Georgenberg
nach Galsterlohe am Ortsende von Georgenberg haben das Staatliche
Straßenbauamt VOH unter der Leitung von Straßenmeister Herrn Peitinger
und das Team von Herrn Karl Feiler durchgeführt.
Herr
Baumer (techn.Amtsrat) vom Staatlichen Straßenbauamt in Amberg/Sulzbach
, verantwortlicher zur Aufstellung der Amphibienzäune, hat Herrn Rainer
Folchmann zum privaten Betreuer der besagten Amphibienzäune bestellt.
Dieser ist gleichzeitig Landschafts- und Naturschutzwart im OWV
Georgenberg. Unterstützt wird Herr Rainer Folchmann durch den Vorstand
des OWV Herrn Manfred Janker. Die anderen 3 Teammitglieder /
Amphibienzähler sind ehrenamtliche Helfer und keine Mitglieder des OWV
Georgenbergs.
Nach der Amphibienzählung soll eine Begehung mit Herrn Bösl vom Bayrischen Staatsforstamt Flossenbürg und mit Frau Rossmann von der Unteren Naturschutzbehörde NEW stattfinden. Dabei werden die jetzigen Lebensräume genau inspiziert. Was muss an Lebensräumen für seltene Pflanzen, Flechten, Reptilien und Amphibien unbedingt erhalten werden und welche Lebensräume müssen so umgestaltet werden, dass sich seltene Pflanzen- und Tierarten heimisch fühlen können. Durch den sehr langen Winter ging die Amphibienwanderung dieses mal ungewöhnlich schnell voran. Die Einsammlung der Amphibien fand 3-4 mal täglich statt. Der Drang der Amphibien ihre Laichplätze zu erreichen war enorm groß. Allgemein war das Ergebnis überwältigend. Neben Erdkröten, Fröschen und Molchen wurden auch bedrohte Tierarten gefunden. Leider mussten wir aber einen Rückgang bei den Bergmolchen, Teichmolchen und Grasfröschen sowie den Wasserfröschen feststellen.
Dafür wurden in 20 Tagen 149 Stunden aufgewendet
und insgesamt 838 km gefahren.
ST 2154 „Kannerskurve“
Vorjahr
'2012
Kröten
656 Stck.
Froscharten:
Wasserfrosch
keinen
(
9 Stck. )
Grasfrosch
6 Stck. (
Vorwarnliste BY )
( 16 Stck. )
Molcharten:
Teichmolch
23 Stck.
( Vorwarnliste
BY )
( 27 Stck. )
Bergmolch
20 Stck.
( 22 Stck. )
ST 2154 „Kohlemeiler“
Kröten 105 Stck.
Froscharten:
Grasfrosch
2 Stck. (
Vorwarnliste BY
)
Molcharten:
Teichmolche
4 Stck.
( Vorwarnliste
BY )
Bergmolche
5 Stck.
ST 2396 am Ortsausgang Georgenberg
Kröten
2221 Stck.
Kreuzkröten
3 Stck.(Rote Liste
Kategorie 2 Bedrohte Art stark gefährdetBY
Froscharten:
Grasfrosch
7 Stck. (
Vorwarnliste BY
)
Springfrosch
keinen
(
1 Stck.)
Molcharten:
Teichmolch
164 Stck.
( Vorwarnliste
BY )
Bergmolch
59
Stck.
( 65
Stck. )
Zauneidechse 1 Stck. ( Vorwarnliste BY )
Insgesamt:
Kröten
2985 Stck.
mit 3
Kreutzkröten ( Rote Liste Kategorie 2 Bedrohte
Art stark gefährdet BY )
Grasfrosch
15 Stck. (
Vorwarnliste BY
)
Teichmolch
191 Stck. (
Vorwarnliste BY
)
Bergmolch
84
Stck.
Zauneidechse
1 Stck.
Fazit:
Allgemein gilt: Neben
der Anlage der Laichgewässer muss eine dauerhafte
Pflege der Strukturen
gewährleistet sein!
Außerdem zählt der
Amphibienzaun als größter im Landkreis NEW!!!
In unserer Gemeinde
Georgenberg sind nicht nur seltene Pflanzen und Tiere gefährdet sondern
auch einige Reptilien b.z.w. Amphibienpopulationen.
(siehe Homepage OWV- Georgenberg)
Vorwarnliste BY
Grasfrosch (Rana temporaria)
Der Grasfrosch (Rana temporaria)
gehört zur Gattung der Echten Frösche in
der Familie der Echten Frösche. Weitere,
allerdings kaum mehr gebräuchliche Trivialnamen sind
unter anderem „Taufrosch“ und „Märzfrosch“.

Merkmale :
Die Kopf-Rumpf-Länge der erwachsenen
Tiere (Adulte) erreicht maximal elf Zentimeter, wobei die
Weibchen aufgrund des etwas späteren Eintritts der
Geschlechtsreife im Durchschnitt geringfügig größer werden als die
Männchen. Die meisten Exemplare sind allerdings zwischen sieben und neun
Zentimetern groß und wirken recht plump. Die Oberseite kann gelb-, rot-
oder dunkelbraun gefärbt sein. Bei manchen Tieren ist diese nur wenig
gezeichnet, andere weisen unregelmäßige schwarze Flecken auf, die
gelegentlich die Grundfarbe fast verdecken können. Die beiden
Rückendrüsenleisten nähern sich im Schulterbereich etwas an. Der
beidseitige, charakteristisch dreieckige Schläfenfleck mit dem darin
befindlichen Trommelfell ist wie bei allen Braunfröschen
deutlich dunkelbraun abgesetzt. Auch die Querstreifung der Hinterbeine
ist ein Merkmal aller Braunfrösche. Die Unterseite ist beim Männchen
weißlich-grau und meist ungefleckt, bei den Weibchen oft gelb und dabei
rötlich marmoriert. Die Schnauzenspitze ist stumpf abgeschrägt und in
der Draufsicht gerundet geformt, die Pupille länglich und
waagerecht ausgerichtet.
Lebensraum und Lebensweise :
Zu den Laichgewässern gehört ein breites Spektrum stehender oder langsam fließender Gewässer. Bevorzugt werden jedoch flachere, von der Sonne beschienene Stillgewässer wie kleine Teiche und Weiher (auch Gartenteiche), die aber selten austrocknen dürfen, oder auch Viehtränken in Grünlandgebieten. Als Laichsubstrat sind Flutrasen beispielsweise aus dem Flutenden Schwaden besonders beliebt. Nach der Eiablage verlassen die Tiere meist sehr rasch das Gewässer und gehen zum Landleben über. Als Habitate werden nun beispielsweise Grünland, Saumbiotope, Gebüsche, Gewässerufer, Wälder, Gärten, Parks sowie Moore besiedelt. Nachts gehen die Frösche auf die Jagd nach Insekten (beispielsweise Käfern und Laubheuschrecken), Asseln, Würmern, Spinnen und Nacktschnecken, tagsüber verstecken sie sich an feuchten Plätzen zwischen Vegetation oder unter Steinen bzw. Totholz. Die Überwinterung erfolgt manchmal am Grund von Gewässern (dann oft kollektiv), überwiegend aber wohl terrestrisch in Erdlöchern und ähnlichen frostfreien Unterschlüpfen. Zuvor im Herbst sind die Tiere meist dem Laichgewässer schon ein Stück entgegengewandert oder nutzen dieses sogar zur Hibernation – Sommerlebensraum und Überwinterungsquartier sind also nicht unbedingt identisch. Zu den Laichgewässern gehört ein breites Spektrum stehender oder langsam fließender Gewässer. Bevorzugt werden jedoch flachere, von der Sonne beschienene Stillgewässer wie kleine Teiche und Weiher (auch Gartenteiche), die aber selten austrocknen dürfen, oder auch Viehtränken in Grünlandgebieten. Als Laichsubstrat sind Flutrasen beispielsweise aus dem Flutenden Schwaden besonders beliebt. Nach der Eiablage verlassen die Tiere meist sehr rasch das Gewässer und gehen zum Landleben über. Als Habitate werden nun beispielsweise Grünland, Saumbiotope, Gebüsche, Gewässerufer, Wälder, Gärten, Parks sowie Moore besiedelt. Nachts gehen die Frösche auf die Jagd nach Insekten tagsüber verstecken sie sich an feuchten Plätzen zwischen Vegetation oder unter Steinen bzw. Totholz.
Die Überwinterung erfolgt manchmal am Grund von
Gewässern (dann oft kollektiv), überwiegend aber wohl
terrestrisch in Erdlöchern und ähnlichen frostfreien Unterschlüpfen.
Zuvor im Herbst sind die Tiere meist dem Laichgewässer schon ein Stück
entgegengewandert oder nutzen dieses sogar zur Hibernation
– Sommerlebensraum und Überwinterungsquartier sind also nicht unbedingt
identisch.
Vorwarnliste BY
Teichmolch (Triturus vulgaris)
Der Teichmolch (Lissotriton vulgaris;
Syn.: Triturus vulgaris; vgl.: Triturus) gehört
zur Klasse der Amphibien und Ordnung der
Schwanzlurche. In Deutschland stellt er die häufigste der bis zu
fünf vorkommenden Arten von Wassermolchen dar.
Teichmolch - Männchen Teichmolch - Männchen Bauchseite


Teichmolch - Weibchen
Teichmolch - Weibchen
Bauchseite


Merkmale :
Der Teichmolch ist ein kleiner Schwanzlurch mit einer Körperlänge von höchstens elf Zentimetern (in Südeuropa weniger). Die Oberseite ist glatthäutig und von gelbbrauner bis schwarzgrauer Färbung. Die Männchen haben darauf – insbesondere zur Paarungszeit auffällig – grobe, rundliche, dunkle Punkte. Bei beiden Geschlechtern verlaufen abwechselnd helle und dunkle Streifen an den Kopfseiten (daher auch der Name „Streifenmolch“); an der Oberseite befinden sich drei Längsfurchen (vergleiche Titelfoto). Die Bauchseite ist in der Mitte orange, zu den Seiten heller werdend und ebenfalls mit dunkler Fleckung versehen – bei den Männchen sind dies große Punkte, bei den Weibchen feine Tüpfel.
In ihrer Wassertracht, die sich erst
nach Eintreffen der Tiere im Laichgewässer entwickelt, haben die
Männchen einen hohen, gewellten bis gezackten (bei südlichen
Unterarten auch glattrandigen), flexiblen Hautkamm, der – im
Gegensatz zum Kammmolch – ohne Einkerbung an der
Schwanzwurzel vom Hinterkopf bis zum Schwanzende verläuft. Ihr
Flossensaum an der Unterseite des seitlich abgeflachten Ruderschwanzes
zeigt einen bläulichen Anflug. Die Hinterfüße weisen in dieser Phase
schwärzliche Schwimmsäume auf. Die Kloake ist bei den
Männchen deutlich stärker hervorgewölbt und dunkler gefärbt als die der
Weibchen. Diese sehen insgesamt viel unscheinbarer aus und weisen meist
eine etwas hellere, eher bräunliche Grundfärbung auf.
Lebensraum und Lebensweise :
Der Teichmolch bevorzugt halboffene bis offene
Landschaften, meidet jedoch dicht bewaldete Bergregionen nicht völlig.
In solchen Gegenden findet man allerdings erheblich häufiger den
Bergmolch und besonders im Westen den
Fadenmolch. In Mitteleuropa begeben sich Teichmolche sehr frühzeitig
nach Ende des Frostes (im Tiefland oft schon ab Februar) auf
Wanderschaft zu ihrem Laichgewässer. Die Hauptlaichzeit erstreckt sich
dann von Ende März bis in den Mai, wenn die Wassertemperatur mindestens
acht Grad Celsius beträgt. Im Wasser sind die Tiere sowohl tag- als auch
nachtaktiv. Teichmolche besiedeln häufig binnen weniger Jahre neu
angelegte Gartenteiche. Teichmolche wie auch die anderen einheimischen
Molcharten bevorzugen fischfreie Gewässer als Fortpflanzungshabitat und
meiden Fischteiche. Auch der Landlebensraum der Molche, der meist in der
direkten Umgebung der Teiche (10-50 Meter) liegt und sich maximal nur
über wenige hundert Meter erstreckt sollte stark strukturiert sein. Hier
sind vor allem zahlreiche feuchte Versteckplätze wichtig, aber auch
frostsichere Verstecke zur Überwinterung. Naturnahe Gärten mit Hecken,
Staudenpflanzen, Wiesenabschnitten, lückenreichen Natursteinmauern,
offenen oder halboffenen Laub- oder Komposthäufen, stellen günstige
Landlebensräume dar. Große hebt insbesondere die Bedeutung von Totholz
(Baumstubben mit loser Rinde, Haufen von Gestrüpp und Reisig, Bretter)
und anderer lose auf der Erde liegender Gegenstände hervor.
Rainer Folchmann
Landschaft -und
Naturschutzwart des OWV-Georgenberg
Die Amphibien-Schutzzäune des Oberpfälzer Waldvereins bei Georgenberg zeigen Wirkung. Die freiwilligen Helfer des OWV konnten
in den vergangenen Tagen bereits über 1.000 Kröten und unzählige Molche einsammeln und sicher zu ihren Laichgewässern bringen.
Dabei werden die Amphibien auch gezählt. Nach dem Abschluss der Zählung wollen die Bayerischen Staatsforsten mit dem Oberpfälzer Waldverein besprechen,
ob das Gelände bei Georgenberg Amphibienfreundlicher gestaltet werden kann. (Quelle: OTV)





Frösche, Lurche, Molche, Kröten – sobald es wärmer wird und es mehrmals richtig regnet, kriechen die Amphibien wieder aus ihren frostsicheren Winterquartieren. Es beginnt ihre Wanderschaft zu den Laichgewässern. Doch auf dem Weg dorthin lauern viele Gefahren. Neben verschiedenen Raubtieren stellt der Straßenverkehr die wohl größte Gefahr für die Tiere dar. Dabei, oder vielleicht auch gerade deswegen, sind besonders viele Amphibien stark bedroht und sollten geschützt werden. In Georgenberg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab wird seit einigen Jahren vermehrt auf den Schutz und Erhalt der seltenen Kriechtiere geachtet. Deshalb wird auch heuer wieder eine Amphibienzählung durchgeführt. Auch die Bevölkerung kann hierbei helfen und Fotos von Amphibien, Reptilien und seltenen Pflanzen oder Informationen zu Fundorten an majanker@t-online.de schicken.
www.otv.de/mediathek/video/2-amphibienzahlung-in-georgenberg/
%20auch%20Europaeische%20Honigbiene%20genannt%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Westliche Honigbiene (Apis mellifera) auch Europäische Honigbiene genannt
%20auch%20Gemeine%20Sumpfschwebfliege%20oder%20Helle%20Sumpfschwebfliege%20genannt%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Gemeine Sonnenschwebfliege (Helophilus pendulus) auch Gemeine Sumpfschwebfliege oder Helle Sumpfschwebfliege genannt
%20gehoert%20zu%20den%20Schmeissfliegen%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Goldfliege (Lucilia serica) gehört zu den Schmeißfliege
Wie einige andere Fliegen auch sind Schmeißfliegen potentielle Träger von pathogenen Keimen und können somit Krankheiten auf Tiere und Menschen übertragen
%20-%20Scheinbiene%20%20oder%20Keilfleckschwebfliege%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Mistbiene (Eristalis tenax) - Scheinbiene oder Keilfleckschwebfliege
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Steinhummel (Bombus lapidarius)
%20Schmetterling%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Weißer Graszünsler (Crambus perlella) Schmetterling
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Dunkle Erdhummel (Bombus terrestris)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Ackerhummel (Bombus pascuorum)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Gemeine Florfliege (Chrysoperla carnea)
%20am%20Meisenknoedl%20im%20Winter%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Hausmaus (Mus musculus) am Meisenknoedl im Winter
%20engl%20%20%20Red%20long-horned%20beetle%20wird%20auch%20Roter%20Halsbock%20bzw%20%20Gemeiner%20Bockkaefer%20genannt%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Der Rothalsbock (Stictoleptura rubra) engl Red long-horned beetle wird auch Roter Halsbock bzw Gemeiner Bockkäfer genannt
%20ist%20ein%20Kaefer%20aus%20der%20Familie%20der%20Aaskaefer%20(Silphidae)%20%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Der Gemeine Totengräber (Nicrophorus vespillo) ist ein Käfer aus der Familie der Aaskäfer (Silphidae)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Verwandtes Goldhaarmoos (Orthotrichum affine)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Der sparrige Runzelbruder (Rhytidiadelphus squarrosus)
%20auch%20Franzoesische%20Feldwespe%20genannt%20zaehlt%20innerhalb%20der%20Familie%20der%20Faltenwespen%20(%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Gallische Feldwespe (Polistes dominula 1 früher P gallica) auch Französische Feldwespe genannt zählt innerhalb der Familie der Faltenwespen
%20mit%20weisser%20Flechte%20(verm%20%20Physcia%20caesia)%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Gewöhnliche Gelbflechte (Xanthoria parietina) mit weißer Flechte (verm Physcia caesia)
%20ist%20eine%20Libellenart%20aus%20der%20Familie%20der%20Segellibellen%20(Libellulidae)%20%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Blutrote Heidelibelle altes Weibchen (Sympetrum sanguineum) ist eine Libellenart aus der Familie der Segellibellen (Libellulidae)
%20Weberknechte%20oder%20Schneider%20(Opiliones)%20gelegentlich%20auch%20Schuster%20Kanker%20oder%20Opa%20Langbein%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die (Riesen-) Weberknechte oder Schneider (Opiliones) gelegentlich auch Schuster Kanker oder Opa Langbein
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Haselmaus am Gehenhammer

Rote Säulenflechte (Cladonia macilenta) in Symbiose mit einer Echte Becherflechte (Cladonia pyxidata ssp. pyxidata)
%20Kategorie%203%20Gefaerhdet%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Furchenbiene (Lasioglossum) Kategorie 3 gefährdet
%20Kategorie%203%20Gefaerhdet%20-%20(2)%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Furchenbiene (Lasioglossum) Kategorie 3 gefährdet
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Schafgarbe (Achillea) " Heilpflanze "
%20oder%20auch%20Goldrauten%20genanntverschiedene%20Schmetterlings-Larven%20nutzen%20Goldruten%20als%20Futterpflanze%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Goldruten (Solidago) oder auch Goldrauten genannt verschiedene Schmetterlings-Larven nutzen Goldruten als Futterpflanze
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Herbstfärbung der Grünen Stinkwanze (Palomena prasina)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Grüne Stinkwanze auch als Gemeine Stinkwanze oder Gemeiner Grünling (Palomena prasina)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Gemeine Feuerwanze (Pyrrhocoris apterus)
%20Nachtschmetterlingsraupe%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Ampfer-Rindeneule (Acronicta rumicis) Nachtschmetterlingsraupe
%20auch%20Heidekraut%20genannt%20%20Sie%20gilt%20als%20Saeurezeiger%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Giftig%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Heilpflanze%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Wildkraut%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Edelfalter%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20ist%20ein%20Edelfalter%20und%20wird%20auch%20als%20Schornsteinfeger%20bezeichnet%20%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20ist%20ein%20Edelfalter%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20%20ist%20eine%20Art%20aus%20der%20Familie%20der%20Teichjungfern%20(Lestidae)%20%20Kleinlibelle%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Edelfalter%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Edelfalter%20mit%20frischen%20Farben%20Mittlere%20Webansich.jpg)

Bericht über die Amphibienzählung- sammlung in der Gemeinde
Georgenberg durch Naturschutzwart des OWV-Georgenberg Rainer Folchmann
Nach einjähriger Verhandlung und
Videoaufnahmen mit dem Straßenbauamt und der Unteren Naturschutzbehörde
war es endlich soweit: Die Krötenwanderungen in unserer Gemeinde sollen
überwacht und registriert werden. Es war die erste Aktion überhaupt in
unserer Gemeinde.
Vorher wurden die Aufstellung der Zäune
und die Problematik der Amphibien mit Herrn Baumer und Herr Folchmann
sowie Frau Zapf von der UNB - NEW vor Ort besprochen.
Die Aufstellung der Amphibienzäune an den
Staatsstraßen ST2154 Georgenberg nach Waldkirch in der „Kannerskurve“
und ST2396 Georgenberg nach Galsterlohe am Ortsende von Georgenberg hat
das Staatliche - Straßenbauamt VOH unter Leitung von Straßenmeister
Herrn Peitinger und das Team von Karl Feiler durchgeführt.
Herr Baumer Technischer Amtsrat vom
Staatlichen Bauamt Amberg Sulzbach der die Amphibienzäune angeordnet
hatte, hat Herrn Rainer Folchmann, Naturschutzwart des OWV-Georgenberg
zum Betreuer der Amphibienzäune dazu bestellt.
Das Team von Herrn Folchmann bestand aus
5 Personen darunter Manfred Janker sowie 2 Personen in Reserve. An jedem
Tag wurden immer zu zweit oder auch zu dritt die Amphibienzäune
begangen.
Dieses geschah je nach Wetterlage bis zu
3mal am Tag.
Dafür wurden in 40 Tagen 282 Stunden
aufgewendet und insgesamt 1482 km gefahren.
Das Ergebnis war überwältigend sind doch
neben den normalen Erdkröten, Fröschen und Molchen auch bedrohte
Tierarten gefunden worden.
Hier die Ergebnise:
ST 2154 „Kannerskurve“
Kröten
655 Stck.
Froscharten:
Wasserfrosch
9 Stck.
Grasfrosch
16 Stck.
( Vorwarnliste BY )
Molcharten:
Fadenmolche
22 Stck.
Teichmolche
27 Stck.
( Vorwarnliste BY )
Bergmolche
22 Stck.
ST 2396 am Ortsausgang Georgenberg
Kröten
2188 Stck.
Kreuzkröten Kreuzkröten
3
Stck.
( Rote Liste Kategorie 2 Bedrohte Art
stark
Froscharten :
Grasfrosch
2 Stck.
( Vorwarnliste BY )
Springfrosch
1 Stck.
( Rote Liste Kategorie 3 gefährdet BY )
Fadenmolche
51 Stck.
Teichmolche
80 Stck.
( Vorwarnliste BY )
Bergmolche
65 Stck.
Große Zauneidechse
1 Stck.
( Vorwarnliste BY )
Fazit:
In unserer Gemeinde Georgenberg sind nicht nur seltene Pflanzen und
Tiere gefährdet sondern auch einige Amphibienpopulationen.
(siehe Hompage OWV- Georgenberg)
Rote Liste Kategorie 2 Bedrohte Art
stark gefährdet BY !!!
Die Kreuzkröte (Bufo calamita)
Aussehen und Maße:
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die kleinste Art
der Echten Kröten (Bufo) ist die Kreuzkröte. Die Kreuzkröte
bleibt kleiner als die Erdkröte (Bufo bufo). Das Männchen der
Kreuzkröte erreicht eine Kopf-Rumpf-Länge von 5 bis 7 (8) Zentimeter und
das Weibchen erreicht ausnahmsweise eine Kopf-Rumpf-Länge von etwa 10
Zentimeter. Ihren deutschen Namen hat sie von einem Längsstreifen in der
Rückenmitte (auf dem Kreuz). Der namengebende Längsstreifen auf der
Rückenmitte kann manchmal schwach sein, unterbrochen oder ganz fehlen.
Es ist dann eine Verwechslung mit der Wechselkröte (Bufo viridis)
möglich, doch läßt sich ein weiteres Merkmal heranziehen. Auf der
Unterseite der längsten Hinterzehe bilden die Gelenkhöcker bei der
Kreuzkröte eine Doppelreihe, während bei der Wechselkröte (Bufo
viridis) nur eine Reihe auf dieser Zehe entlang läuft. Ihre
Oberseite ist dunkelbraun bis beige, olivgrün marmoriert, kann schwach
ausgeprägt sein. Die Unterseite ist weiss bis hellgrau und kann dunkel
gefleckt sein.
Verbreitung:
Die Kreuzkröte ist eine westliche Art, deren Verbreitung von
Südwesteuropa, Westeuropa sowie Mitteleuropa bis Weißrussland reicht.
Südlich fehlt die Kreuzkröte in Italien, Griechenland, Slowenien,
Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien. In
Großbritannien ist sie stellenweise anzutreffen, die inselartigen
Verbreitungsgebiete hängen aber nicht mehr zusammen. Im Norden reicht
das Verbreitungsgebiet der Kreuzkröte bis nach Dänemark und im Süden von
Schweden. In den Alpen und auf der Alpensüdseite fehlt die Kreuzkröte
ebenfalls. Die Lebensräume der Kreuzkröte entsprechen ihrer Neigung zur
Wärme und Trockenheit. Steinbrüche, Sand- und Kiesgruben stellen heute
ihre optimalen Biotope dar.
Gefährdungen und
Beeinträchtigungen:
Verlust von
Primärlebensräumen allgemein,
grundsätzliche
Unterbindung der Dynamik durch Gewässerverbauung bzw. sofortige
Beseitigung von Auflandungen und Tümpeln nach Hochwässern,
Rekultivierung von
Abbaustellen mit Beseitigung von Gewässern und Kleinstrukturen,
Veränderung der Abgrabungstechnik in Abbaugebieten wodurch die Dynamik
auf der Fläche verloren geht,
Wegfall bäuerlicher oder
kommunaler Kleinabbaustellen,
Intensivierung der
Landbewirtschaftung im direkten Umfeld (Einzugsgebiet) der Laichgewässer
insbesondere Umwandlung von Grünland in Ackerflächen,
Einsetzen von Fischen oder
Krebsen in Laichgewässer,
Sukzession von
Kleingewässern und dadurch zunehmende Besiedlung durch Großwasserkäfer,
Großlibellen oder andere
Amphibienarten,
Zerschneidung von
Lebensräumen insbesondere Trennung von Laichgewässern und
Landlebensräumen / Winterquartieren,
Zunehmende Isolierung von
(Rest-) Populationen.
Mögliche
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen:
Erhaltung und Neu
Anlage von Pufferstreifen
um nachgewiesene Laichgewässer (-komplexe), die Nähr- und
Schadstoffeinträge aus angrenzenden Intensivnutzungen verhindern,
Umwandlung von
Ackerflächen in extensiv genutzte Grünlandflächen im Umfeld,
Renaturierung von Fließgewässern um eine standörtliche Vielfalt
wiederherzustellen und insbesonders um die Bildung von
Überschwemmungstümpeln zu ermöglichen,
Umsetzung geeigneter
Amphibienschutzmaßnahmen an Straßen im Bereich der Wanderkorridor:
Allgemein
gilt: Neben der Anlage der Laichgewässer muss eine dauerhafte
Pflege
der Strukturen gewährleistet sein!
Rote Liste Kategorie 3 gefährdet BY !!!
Der Springfrosch:
Springfrösche sind schlanke, langgliedrige Froschlurche mit einer
spitzen Schnauze. Die Kopf-Rumpf-Länge der Männchen reicht selten über
6,5 Zentimeter, die der Weibchen bis 9 Zentimeter. Die Oberseite ist
hellbraun, rotbraun oder auch hell graubraun („falllaubfarben“) und
nicht selten manchmal gefleckt. Die braunfroschtypischen dreieckigen
Schläfenflecken mit dem Trommelfell sind dunkelbraun. Die Unterseite ist
weißlich und meist ganz ungefleckt. Während der Paarungszeit sind die im
Wasser befindlichen Männchen oft dunkelbraun verfärbt. Auf Ober- und
Unterschenkeln zeigen sich dunkle Querbänder, die aber kein alleiniges
arttypisches Merkmal sind. Die Hinterbeine sind auffallend lang, wodurch
die Art sehr sprunggewandt ist: sie kann ein bis zwei Meter weite Sätze
machen. Die Pupillen sind waagerecht; die Iris ist im oberen Drittel
(oberhalb der Pupille) heller goldfarben als seitlich und unterhalb der
Pupille. Das Trommelfell erreicht etwa die Größe des Augendurchmessers
und befindet sich jeweils sehr dicht hinter dem Auge. Die Drüsenleisten
auf dem Rücken sind nicht sehr stark ausgeprägt und stellenweise
unterbrochen.
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Lebensraum:
Die Springfrösche bevorzugen als Fortpflanzungsgewässer Tümpel in oder
in unmittelbarer Nähe von lichten Laubmischwäldern. Diese sollten
mindestens teilweise besonnt sein, viel Wasserpflanzen enthalten und
starken Wasserstandsschwanken unterliegen. Gewässer mit Fischbesatz
werden gemieden. Südlich der Alpen scheinen die Springfrösche weniger
anspruchsvoll zu sein. Sie besiedeln dort auch andere Typen von
stehenden Gewässern.
Im Sommer lebt der Springfrosch in warmen, lichten und eher trockenen
Laubmischwäldern, die teilweise mehr als 1 km weit vom Laichgewässer
entfernt liegen. Innerhalb der Wälder werden Gebiete mit reicher
Strauchschicht besiedelt die gut besonnt sind wie etwa Lichtungen,
Wegränder oder Schneisen. Er ist dort vor allem in der Dämmerung aktiv.
Die Springfrösche besiedeln auch das Umland des Waldes sofern dieses
durch Hecken mit diesem vernetzt ist. Sie sind wärmeliebender als die
Moorfrösche oder Grasfrösche und auch resistenter gegen Trockenheit.
Gefährdung:
Zerstörung von Auwaldresten
Forstwirtschaft mit Monokulturen statt natürlichem Waldbau
Strukturarme Flachwasserbereiche der Laichgewässer.
Naturschutz:
Der Naturschutz dient der Erhaltung schutzwürdiger Landschaften und
Landschaftsteile durch ordnende, sichernde, regenerierende, pflegende
und entwickelnde Maßnahmen im Naturhaushalt der Landschaftsökosysteme,
der feien Landschaft und im Siedlungsraum.
Die Maßnahmen zielen
darauf ab, die natürlichen oder quasi-natürlichen Lebensräume vor
schädigenden Einwirkungen und übermäßigen wirtschaftlichen Nutzungen zu
schützen und sie in ihrer ökologischen Leistungsfähigkeit, Vielfalt und
Schönheit als eine der Lebensgrundlagen von Mensch, Tier und Pflanze zu
erhalten.
Artenschutz:
Unter Artenschutz versteht man alle Maßnahmen zum Schutz von Tier- und
Pflanzenarten, auch als Bestandteil regenerations- und funktionsfähiger
Ökosysteme und zur Erhaltung der Artenvielfalt.
Dabei kann es insbesondere beim Schutz stark gefährdeter oder vom
Aussterben bedrohter Amphibien- und Reptilienarten zu Konflikten
zwischen den Zielen des auf diese Arten ausgerichteten Artenschutzes und
Naturschutzzielen kommen. Ursache ist zumeist das Fehlen von
"natürlichen" Primärstandorten, die aufgrund des allgemeinen Verlustes
der Dynamik unserer Landschaft (z.B. in Flussauen) selten geworden sind.
Viele Arten sind deshalb heute auf Sekundärstandorte angewiesen, die
aufgrund extremer Nutzungen (Truppenübungsplätze, Abgrabungen)
entstanden sind
Rainer Folchmann
Naturschutzwart des OWV-Georgenberg
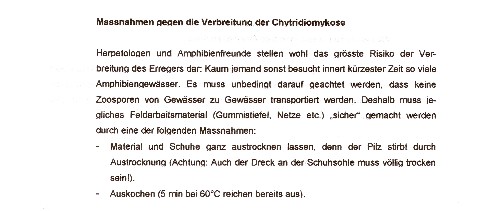
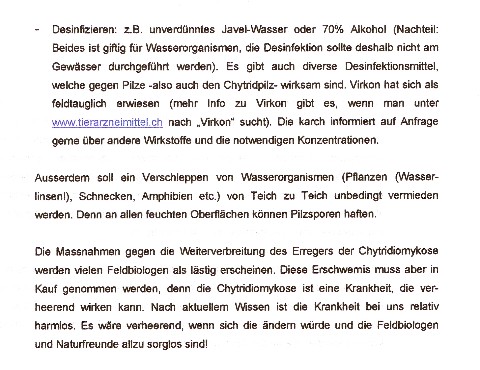





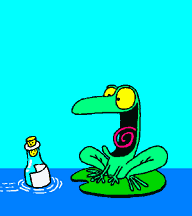
12.11.2012
Rote Liste Vorwarnliste der
Bedrohten Art
Zauneidechse (Lacerta agilis)
Im deutschsprachigen Raum erreichen
Zauneidechsen ausnahmsweise Gesamtlängen von etwa 24 cm. Besonders große
Tiere weisen hier Kopf-Rumpf-Längen von etwa 9,5 cm und Schwanzlängen
von etwa 14 cm auf. Die größte bekannte Kopf-Rumpf-Länge von 11,5 cm
stammt von einer Zauneidechse aus dem Kaukasus. Generell haben die
Weibchen längere Rümpfe, die Männchen dagegen längere Köpfe und
geringfügig längere Schwänze.Die Färbung und Zeichnung ist je nach
Individuum, Geschlecht, Altersstadium und Jahreszeit (Männchen!) sehr
variabel. Oft verläuft auf der Rücken- und Schwanzmitte ein
„leiterartiges“ Zeichnungsmuster aus hellen Seitenlinien
(Parietalbänder) und dunkelbraunen „Quersprossen“ (Dorsalflecken) mit
braunen Zwischenräumen. Mittig sowie seitlich über die Dorsalflecken
verlaufen zudem meist weißliche, unterbrochene Längsstriche (Occipitallinie
sowie Parietallinien). Auch die Grundfarbe von Oberkopf, Schwanz und
Gliedmaßen ist bräunlich und die Flecken der Flanken sind ebenfalls
weißkernig. Die Männchen zeigen zur Paarungszeit (bis Juni/Juli) grün
gefärbte Kopf-, Rumpf- und Bauchseiten; besonders in Südwestdeutschland
kommen auch Tiere vor, die nahezu insgesamt grün erscheinen. Eine
weitere Besonderheit sind rotrückige Exemplare. Die Unterseite ist bei
den Weibchen gelblich und fleckenlos, bei den Männchen grün mit
schwarzen Flecken. Die Jungtiere besitzen eine bräunliche Färbung, oft
mit auffälligen Augenflecken auf Rücken und Seiten.
Lebensraum
Zauneidechsen, als bezüglich ihrer
Lebensraumstrukturen stark anthropogen geprägte Lebewesen, besiedeln
Magerbiotope wie trockene Waldränder, Bahndämme, Heideflächen, Dünen,
Steinbrüche, Kiesgruben, Wildgärten und ähnliche Lebensräume mit einem
Wechsel aus offenen, lockerbödigen Abschnitten und dichter bewachsenen
Bereichen. In kühleren Gegenden beschränken sich die Vorkommen auf
wärmebegünstigte Südböschungen. Wichtig sind auch Elemente wie Totholz
und Steine.
Gefährdung
Bestände der Zauneidechse werden vor
allem durch die Zerstörung von Lebensräumen und Kleinstrukturen in der
Landschaft dezimiert. Dazu gehören etwa die Rekultivierung von
sogenanntem „Ödland“, die Wiederbewirtschaftung von Brachen, der Verlust
von Randstreifen und Böschungen, allgemein eine intensive Landwirtschaft
oder auch die Fragmentierung der Landschaft durch Straßenbau bzw.
-verkehr und Siedlungsbau. In der Nähe menschlicher Siedlungen kann eine
hohe Bestandsdichte von freigehenden
Hauskatzen eine ernste Gefahr für Eidechsen
darstellen.
%20aus%20der%20Familie%20der%20Echten%20Eidechsen%20(Lacertidae)%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Vorwarnliste%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20(2)%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Kiefernschwärmer (Nachtschmetterling)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Der Gundermann (glechoma hederacea)
%20Nachtschmetterling%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Kiefernschwärmer oder auch Tannenpfeil (Sphinx pinastri) Nachtschmetterling
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Kiefernschwärmer (Nachtschmetterling)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Der Gewöhnliche Dornfarn oder Karthäuserfarn (Dryopteris carthusiana syn Dryopteris spinulosa)
%20Samp%20%20Polygonum%20bistorta%20L%20%20Bistorta%20major%20S%20F%20Gray)%20auch%20Wiesen-Knoeteri%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Der Schlangen-Knöterich (Bistorta officinalis Syn Persicaria bistorta (L ) Samp Polygonum bistorta L Bistorta major S F Gray) auch Wiesen-Knöteri
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Lupine Weiss (Lupinus polyphyllus)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Lupine Blauviolett-Weiss (Lupinus polyphyllus)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Lupine Weiss-Rosaviolett (Lupinus polyphyllus)
%20(2)%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Lupine Blau-Violett (Lupinus polyphyllus)
%20auch%20Gelbe%20Teichmummel%20oder%20Teichkandel%20genannt%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Gelbe Teichrose (Nuphar lutea, Syn. Nuphar luteum), auch Gelbe Teichmummel oder Teichkandel genannt
%20auch%20Wald-Akelei%20genannt%20und%20Rot-Weiss%20eine%20Beet-Akelei%20AquilegiaCaerulea-Hybr%20%20Mc%20Kana%20%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
In Blau die Gemeine Akelei (Aquilegia vulgaris), auch Wald-Akelei genannt und Rot-Weiss eine Beet-Akelei Aquilegia–Caerulea-Hybr. Mc Kana.

Wild-Akelei Weiss Aquilegia vulgaris 'Alba'
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Gelbe Schwertlilie (Iris pseudacorus)
%20(2)%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Tigerschnegel (Limax maximus)
%20(2)%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Rote Wegschnecke (Arion rufus)
Die Rote Wegschnecke ist auf der Roten Liste in Bayern Kategorie 3 als
" gefährdet " eingestuft " BITTE NICHT BEKÄMPFEN " Eine " Spanische Wegschnecke " ist im Vordergrund
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Rote Wegschnecke links (Arion rufus)
Die Rote Wegschnecke ist auf der Roten Liste in Bayern Kategorie 3 als
" gefährdet " eingestuft " BITTE NICHT BEKÄMPFEN "
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Rote Wegschnecke rechts (Arion rufus)
Die Rote Wegschnecke ist auf der Roten Liste in Bayern Kategorie 3 als
" gefährdet " eingestuft " BITTE NICHT BEKÄMPFEN "
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Roter Wiesenklee (Trifolium pratense)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Weisser Wiesenklee (Trifolium repens L)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Marien Distel (Silybum marianum)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Marien Distel (Silybum marianum)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Löwenzahn (Leontodon)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Gamander Ehrenpreis (Veronica chamaedrys)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Scharfer Hahnenfuss (Ranunculus acris)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Echter Wurm-Farn (Dryopteris filix-mas)
%20%20Heilkraut%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Gewöhnlicher Löwenzahn - Pusteblume (Taraxacum sect Ruderalia) Heilkraut
" Eßbar "
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Gewöhnlicher Löwenzahn (Taraxacum sect Ruderalia)
" Eßbar "
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Tauwurm (Lumbricus terrestris)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Felsen-Steinkraut (alyssum saxatile)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris syn Arion lusitanicus auctt non Mabille 1868)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Gartenbänderschnecke (Cepaea hortensis)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Gartenbänderschnecke (Cepaea hortensis)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Gartenbänderschnecke (Cepaea hortensis)
%20ein%20Wildgemuese%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa) ein Wildgemüse
ein Wildgemüse eßbar
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Gänseblümchen (Bellis perennis)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Sumpfdotterblume (Caltha palustris)
%20(2)%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Sumpf-Vergissmeinicht (Myosotis scorpioides)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella)
%20(2)%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Teichmolch Vorwarnliste
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Teichmolch Vorwarnliste
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Teichmolch Vorwarnliste
10.04.2012
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Teichmolch-Bauchseite (Triturus vulgaris) Vorwarnliste
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Bergmolch-Bauchseite (Triturus alpestris)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Teichmolch-Männchen (Triturus vulgaris). Vorwarnliste
%20-%20Kopie%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Bergmolch-Männnchen (Triturus alpestris)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Teichmolch- Weibchen (Triturus Vulgaris) Vorwarnliste
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Bergmolch
weibchen (Triturus alpestris)
%20(2)%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Gesäter Tintling (Coprinus disseminatus)
"Giftig"!!!
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Gesäter Tintling (Coprinus disseminatus)
"Giftig"!!!


Fotografiert von Gert Folchmann
Fotografiert von Gert Folchmann
08.04.2010






%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20auch%20als%20Acker-Taeschelkraut%20Acker-Pfennigkraut%20oder%20Ackertaeschel%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Das Acker-Hellerkraut (Thlaspi arvense) auch als Acker-Taeschelkraut Acker-Pfennigkraut oder Ackertaeschel
07.09.2009
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
gefährdet Kategorie 3
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20auch%20Vogel-Sternmiere%20oder%20Huehnerdarm%20genannt%20ein%20Wildkraut%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Die Gewoehnliche Vogelmiere (Stellaria media) auch Vogel-Sternmiere oder Huehnerdarm genannt ein Wildkraut

Fotografiert von Rainer Folchmann, Naturschutzwart
Fotografiert von Rainer Folchmann, Naturschutzwart






%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)




Gefährdung anzunehmen





%20auch%20Weiss-Gaensefuss%20genannt%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Der Weisse Gaensefuss (Chenopodium album) auch Weiss-Gaensefuss genannt
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Das behaarte Knopf- oder Franzosenkraut (Galinsoga ciliata)

Biber
%20(2)%20Mittlere%20Webansicht.jpg)
Trompetenflechten (Cladonia fimbriata)
Potentiell Bedrohte Art Kategorie 4

Echte Rentierflechte (Cladonia rangiferina)
Bedrohte Art der Kategorie I
„Der Naturschutz-Schaukasten ist wirklich schön geworden.“ Manfred Jankers Feststellung bei der Präsentation am 28. September bei der Alten Mühle in Gehenhammer konnten alle Gäste nur bestätigen. Für den Vorsitzenden des Oberpfälzer Waldvereins zählt der Naturschutz mit zu den vorrangigen Aufgaben.
„Aber wenn wir nicht so großartige Unterstützung erhalten hätten, wäre
die Aktion nichts geworden“, lobte er alle am Werk Beteiligten. Das war
zunächst der Hauptinitiator Johann Bock. „Unser Naturschutzwart hat den
Anstoß gegeben und die Maßnahme federführend begleitet“, informierte
Janker.
Seinen Worten zufolge hatte die Firma Kochendörfer Wasserkraftanlagen in
Galsterlohe die Winkeleisen gestiftet, während das Unternehmen Max Bock
für das Sandstrahlen und Lackieren, der Spenglermeister Siegfried Völkl
für das Einblechen, Peter Meyer für die Lieferung des Glases und Josef
Scheibl für Arbeiten in seiner Werkstatt verantwortlich gezeichnet
hatten.
Die zur Verfügung gestellten Tiere stammen vom Hauptkassier Josef
Woppmann, Vogelschutzwart Willibald Gleißner, Katharina und Josef
Helgert (Hinterbrünst), Josef Helgert (Schwanhof) und Peter Schicker.
Jankers Stellvertreter Ludwig Herrmann sowie Marita und Holger Osgyan
haben den Schaukasten dann eingerichtet und in Form gebracht.
„Unser Naturschutz-Schaukasten wertet die Mühle Gehenhammer weiter auf“,
meinte der Vorsitzende. „Sie ist schließlich unser Aushängeschild.“
Enthalten darin sind jede Menge einheimische Tiere, darunter Bussard,
Habicht, Eichhörnchen, Tannenhäher, Meise, Fasan, Baummarder,
Steinmarder, Hornisse, Wespe, außerdem ein Wespen-,
Hornissen-, Meisen-, Bachstelzen-, Hausrotschwanz, Mönchsgrasmücke- und Kleibernest sowie
Baumflechten, Moose, Zunderschwamm von Fichte und Buche und
Getreidehalme von einheimischen Sorten.

Eigentlich hätte sie der Zweigverein Georgenberg selbst
an einen schönen Ort pflanzen wollen. „Da hat aber die Höhere
Naturschutzbehörde bei der Regierung der Oberpfalz ein Veto eingelegt“,
bedauerte Vorsitzender Manfred Janker. „Also mussten wir eine Lösung für
die von Alexandra Gürtler gezüchteten 350 Arnikas finden. Sie dürfen
nämlich nicht unkontrolliert in die Natur.“ Das ist dem OWV gelungen.
Am 24. September holte sie Konrad Uschold persönlich bei Alexandra
Gürtler in Leßlohe ab. Der Oberlinder ist im Freilandmuseum
Neusath-Perschen als Bauhof-Leiter beschäftigt und dabei unter anderem
für die Flora und Fauna verantwortlich. Als er die riesige Menge der
Pflanzen sah, konnte er nur noch staunen: „Das ist ja der helle
Wahnsinn.“
Alexandra Gürtler hatte mit der Züchtung der OWV-Symbole im Februar /
März dieses Jahres in einem Gewächshaus begonnen und die Pflänzchen
gehegt und gepflegt. „Das war mit jeder Menge Arbeit verbunden“,
erzählte die Naturliebhaberin. „Ich musste auch nachpflanzen.“ Die
Züchtung verglich sie in etwa mit dem Aufpäppeln eines kleinen Tieres.
„Ich habe die Arnikas mit der Sprühflasche groß gezogen“, erklärte sie.
Für Janker ist die Leßloherin deshalb auch die „Arnika-Mutter, die jede
Menge Zeit und Arbeit investiert hat“. Dafür zollte er ihr zusammen mit
Uschold ein Riesenkompliment und Lob. „Viele reden nur darüber,
Alexandra Gürtler hat es gemacht“, anerkannte Uschold. Der Dank des
OWV-Vorsitzenden ging nicht zuletzt auch an Christiana Hanauer von der
Regierung der Oberpfalz, welche die Übergabe der Arnikas an das
Freilandmuseum Neusath-Perschen eingefädelt hatte. Dieses ist laut
Uschold „das in Bayern am längsten beobachtete Naturschutzgebiet“.
%20Mittlere%20Webansicht.jpg)

%20Mittlere%20Webansicht.jpg)




Erdkröte (Bufo Bufo)

